Wertschriftensparen – nichts leichter als das!
Wertschriftensparen ist ganz einfach. Ich suche eine Bank mit möglichst tiefen Kosten und eröffne dort ein Wertschriftendepot. Je nach Investitionshöhe wird dies ein Fondsparplan sein oder bei grösseren Investitionssummen eine individuelle Vermögensverwaltung. Ist das aber wirklich schon der ganze Zauber?
Das Handwerk «Wertschriftenverwaltung»
Die Finanzbranche neigt dazu komplizierte und undurchsichtige Anlageprodukte mit schönen Prospekten zu kreieren. Aus unserer Sicht ist das nicht nötig. Eine sorgfältige Auswahl an qualitativ guten Titeln aus verschiedenen Branchen und mit Firmenumsatz in verschiedenen Weltregionen ist vollkommen ausreichend. Die konsequente Umsetzung der definierten Strategie und das Durchhalten von Kurskorrekturen sind zentral.
Worauf achten wir bei der Wahl des geeigneten Vermögensverwalters?
Kosten
Auch wir legen ein Augenmerk auf die Kostenstruktur. Höhere Kosten bedeuten schlussendlich eine tiefere Rendite. Die Frage ist, ob bei einem Vergleich auch wirklich alle Kosten miteinander verglichen werden. Oftmals enthalten Wertschriftenprodukte versteckte Kosten, welche auf den ersten und allzu oft auch auf den zweiten Blick nicht ersichtlich sind. Daher empfehlen wir in unserer Beratung Produkte mit klarer Kostenstruktur und Direktanlagen in Aktien oder Obligationen. Fonds versuchen wir, wenn immer möglich, zu vermeiden.
Diversifikation
Diversifikation ist ebenfalls ein zentrales Thema. Um eine optimale Diversifikation zu erreichen, benötigt ein Depot zwischen 20 und 30 Aktien. Mit einem Wertschriftendepot, welches direkt in Aktien investiert, ist dies leicht zu erreichen. Eine Anlage in Fonds oder ETFs führt zwangsläufig zu einer Verzettelung der Anlagen. Rasch sind über die verschiedenen Anlagegefässe gesehen hunderte von Aktien im Depot. Gleiche Aktien kommen in mehreren Fonds oder ETFs vor, Regionen und Branchen überschneiden sich – kurz es hat niemand mehr den Überblick in was genau investiert wird.
Eine Bank versus mehrere Banken
Das gleiche Problem wie bei der Diversifikation besteht, wenn das Geld durch verschiedene Banken verwaltet wird. Es besteht ein privates Wertschriftendepot bei der Bank A, das Säule 3a Konto ist bei Bank B investiert und die BVG 1e-Lösung bei Bank C angelegt.
Uns ist es wichtig, dass das private Wertschriftendepot mit der BVG 1e-Lösung harmoniert. Sprich steuerfreie Anlagen befinden sich im freien Vermögen, steuerpflichtige Anlagen in der steuerprivilegierten BVG-Lösung. Wird eine Frühpensionierung angestrebt, dann muss das 1e-Geld nahtlos und ohne Umschichtung der Anlagen ins Freizügigkeitsdepot überführt werden können und per ordentlichem Pensionszeitpunkt dann auch eins zu eins ins freie Vermögen transferiert werden können. Nur mit einer solchen Durchlässigkeit der verschiedenen Anlagegefässe kann eine optimale langfristige Anlagestrategie verfolgt werden.
Was ist uns sonst noch wichtig?
Nebst der reinen Vermögensverwaltung ist uns auch die persönliche Komponente wichtig. Gerade bei individuell verwalteten Wertschriftendepots ist es wichtig, dass eine langjährige Partnerschaft zwischen Kunde und Berater entsteht. Daher arbeiten wir mit Privatbanken zusammen, welche traditionell eine sehr tiefe Fluktuation bei den Kundenberatern aufweisen. Kontinuität in der Kundenberatung erachten wir als ein wichtiges Kriterium. Ein Jahresgespräch soll nicht ein jährliches Kennenlernen des neuen Beraters sein, sondern eine Fortführung des bisher Aufgebauten. Ein Patient will seinen Hausarzt ja auch nicht bei jeder Konsultation wechseln müssen.
Wir sind überzeugt, Ihnen mit unseren Lösungen eine gute und massgeschneiderte Wertschriftenverwaltung anbieten zu können und freuen uns, Ihnen diese vorstellen zu dürfen.
Roth Gygax & Partner AG*
Moosstrasse 2
3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00
mail[at]fmhinsurance.ch
www.fmhinsurance.ch
*Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Die neue Start-up-Generation – kauft die Katze nicht im Sack!
Wichtige Tipps für die Praxisübernahme — Der Entschluss, die ärztliche Tätigkeit selbstständig in der eigenen Praxis fortzusetzen, kommt einem Wendepunkt im Leben gleich. Die Ärztin bzw. der Arzt verlässt ein bekanntes, auf eine Institution begrenztes Netzwerk und begibt sich in ein offenes System von Kooperationspartnern aus dem ärztlichen, pflegerischen und sozialen Bereich. Als selbstständig praktizierende Ärztinnen und Ärzte übernehmen sie Eigenverantwortung für den gesamten beruflichen und ökonomischen Bereich. Das ist eine grosse, aber auch eine dankbare Herausforderung.
Falls Sie sich für die Übernahme einer Praxis oder eines Praxisanteils entscheiden, sollten Sie die Komplexität der Praxisübernahme nicht unterschätzen. Die erfolgreiche Übernahme einer bestehenden Unternehmung erfordert viel Geschick, Energie und Fachwissen und vor allem eine gute Planung.
Was Sie beachten müssen: die 10 wichtigsten Regeln der Praxisübernahme
Damit Sie die Angebote entsprechend kompetent prüfen und Fehlentscheide vermeiden können, hier die wichtigsten Tipps und Hinweise direkt aus der Praxis.
1. Tipp: Prüfen/vergleichen Sie mehrere Angebote/Objekte, bevor Sie sich entscheiden
Die Besichtigung und Prüfung verschiedener Objekte ist wichtig, um Ihre eigenen Vorstellungen zu festigen/prüfen. fühlen Sie sich in der Praxis? War Ihnen die Praxisinhaberin / der Praxisinhaber sympathisch? Was hat Ihnen gut gefallen, und was hat Ihren Vorstellungen nicht entsprochen? Welchen Eindruck hat die Praxis insgesamt bei Ihnen hinterlassen? Ob 5 oder 10 Objekte, ist nicht entscheidend. Dieser Prozess muss Sie in Ihren Grundsatzentscheiden jedoch bestätigen.
-> Wichtig bei der Besichtigung ist, dass Sie sich nach jeder Praxis die gleichen Fragen stellen und Ihre Gedanken dazu schriftlich festhalten.
2. Tipp: Verlangen Sie die Praxisbewertung
Idealerweise liegt eine Praxisbewertung vor, damit Sie alle relevanten Informationen über die Praxis schwarz auf weiss nachlesen können: Standortbeurteilung, Konkurrenzsituation, Notfalldienst-Regelung, Personalsituation, Praxisgrösse, Mietvertrag, Praxisform, medizinisches Leistungsspektrum, Inventar, betriebswirtschaftliche Kennzahlen usw. Die Praxis sollte möglichst umfassend und neutral beschrieben werden. Und es sollte natürlich auch der Unternehmenswert objektiv bewertet werden, damit eine Diskussionsgrundlage für allfällige Verhandlungen vorliegt. So können Sie die Informationen überprüfen und mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner oder einer Beraterin / einem Berater diskutieren.
-> Ausserdem können Sie so mehrere Angebote besser vergleichen und sich ein Bild von der Ertragskraft und dem Kaufpreis machen.
3. Tipp: Vollständige Jahresabschlüsse der letzten 3–5 Jahre (Bilanz/Erfolgsrechnung) sind ein Muss
Der Jahresabschluss stellt die finanzielle Lage und den Erfolg eines Unternehmens am Ende eines Geschäftsjahres dar. Der Jahresabschluss beinhaltet die Bilanz und die Erfolgsrechnung. Die Bilanz gibt Auskunft über die Aktiva und die Passiva eines Unternehmens. In der Erfolgsrechnung werden Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres aufgeführt. Nicht selten verweigern jedoch die Praxisinhaber den interessierten Kolleginnen/Kollegen die Jahresabschlüsse. Sie seien zu persönlich und zu privat. Damit Sie das Objekt genauer prüfen können, ist ein Bild von der Ertragskraft und der finanziellen Lage des Unternehmens unumgänglich. Falls Sie für die Prüfung der Abschlüsse nicht die Kenntnisse haben, empfehlen wir Ihnen, sich Hilfestellung bei externen Beraterinnen/Beratern zu holen.
-> Wichtig: kein finanzielles Engagement ohne Fakten!
4. Tipp: Prüfen Sie die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen anhand der offiziellen Statistiken
Liegt eine aktuelle Rechnungssteller-Statistik von santésuisse oder das Management-Summary des TrustCenters vor? Wie sind die Umsatzentwicklung und die Entwicklung der Patientenzahlen der letzten 5 Jahre? Stabil oder eher rückläufig? Hat sich die Praxisinhaberin / der Praxisinhaber geistig bereits entschlossen, das Unternehmen aufzugeben?
-> Wenn die Patientenzahlen kontinuierlich sinken, dann ist Vorsicht geboten!
5. Tipp: Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit (Anova-Index)
Gemäss Art. 32 KVG müssen Leistungen wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein. Als statistische Methode zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit wird die Varianzanalyse festgelegt, und mittels dieser Methode ermittelt santésuisse den Anova-Index des Leistungserbringers. Ab Anova-Index der totalen Kosten >130 wird ein Arzt auffällig und riskiert ein Verfahren wegen Unwirtschaftlichkeit.
-> Ein zu hoher Anova-Index muss bei der Beurteilung einer Praxis berücksichtigt werden.
6. Tipp: Analysieren Sie die Altersstruktur des Patientenguts und das Leistungsangebot der Praxis
Passen sie zu Ihnen? Wie beurteilen Sie die Altersstruktur der Patientinnen/Patienten? Hat die Praxis die richtigen oder die falschen Patientinnen/Patienten für Sie? Werden Sie einen Teil des Patientenguts verlieren, weil Sie nicht das gleiche Leistungsangebot wie die Vorgängerin / der Vorgänger anbieten?
-> Es gilt, diese Fragen möglichst ehrlich zu beantworten und in der Entscheidungsfindung entsprechend zu berücksichtigen.
7. Tipp: Wenn möglich, schauen Sie sich die Praxis nicht nur von aussen an
Hospitation, Praxisassistenz oder Stellvertretung bieten die Möglichkeit, die Praxis von innen kennenzulernen. Prüfen Sie, ob das Unternehmen Ihren Fachgebieten, Fähigkeiten und Ihren Bedürfnissen entspricht. Stimmt die Behandlungsphilosophie der Verkäuferin / des Verkäufers mit Ihrer überein? Sie sollten beachten, dass es kein perfektes Unternehmen, keine Praxis ohne Nachteile gibt.
-> Wichtig ist, dass die Eindrücke und Erlebnisse, die Sie während der «Schnupperzeit» gewonnen haben, Sie in Ihrem Vorhaben bestätigen.
8. Tipp: Miete macht freier!
Günstigere Hypothekarzinsen oder teurere Miete? Flexibilität oder Gebundenheit? Viele Expertinnen/Experten in der Finanzbranche sind der Meinung, dass der Kauf einer Immobilie günstiger ist als Miete. Doch die Erfahrung zeigt, dass sich die jüngere Ärztegeneration in einem Mietverhältnis freier, flexibler und unabhängiger fühlt. Insbesondere bei Gewerberäumlichkeiten ist zu berücksichtigen, dass sich über die Jahre z. B. das Zentrum der Gemeinde verschieben kann (z. B. zwischen zwei Gemeinden wird ein neuer Bahnhof gebaut, der Discounter zieht ebenfalls um, oder es wird ein neues Gemeindehaus gebaut, und Schritt für Schritt verlagert sich das Zentrum der Gemeinde). Die Anforderungen an den «optimalen» Standort können sich ebenfalls verändern. Früher wurden Hausarztpraxen häufig in einem Wohnquartier gebaut, jetzt vielfach beim Bahnhof. Aber auch die persönliche Situation kann sich verändern (Umzug, Scheidung, gesundheitliche Probleme usw.). Wer mietet, bleibt flexibler! Andererseits muss auch beachtet werden, dass ein Unternehmen wie eine Arztpraxis eine gewisse Stabilität, Kontinuität und Planungssicherheit benötigt.
-> Langfristige Mietverträge mit (wenn möglich) einseitiger Kündigungsmöglichkeit sollten daher Ihr Ziel sein.
9. Tipp: Seien Sie mutig und bereit, die Praxislandschaft zu verändern
Die jungen Ärztinnen und Ärzte erlernen ihren Beruf unter stark veränderten Verhältnissen, und Teamdenken wie auch Work-Life-Balance haben bei ihnen ganz andere Prioritäten als bei früheren Generationen. Dies erfordert neue Formen der Leistungserbringung. Die heutige Arztpraxis wird sich diesen Entwicklungen anpassen müssen. Die hohen Präsenzzeiten, der Notfalldienst und die starren Strukturen der bisherigen Praxislandschaft werden vermehrt in Frage gestellt. In der Vergangenheit wurde die Praxislandschaft von Einzelpraxen dominiert, die Gruppenpraxen waren absolute Ausnahmen. Heutzutage sind Gruppenpraxen in verschiedenen Formen im Trend. Es gibt diverse Varianten, wie Sie in eine Praxis einsteigen oder eine Praxis/einen Praxisanteil übernehmen können: Anstellungsverhältnis, Infrastrukturnutzung, Junior/Senior-Modell, Partnerschaft, stufenweise Praxisübernahme (Sukzession), Beteiligung an einer Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
-> Prüfen Sie alternative Formen zur Selbständigkeit, und finden Sie Ihren Weg!
10. Tipp: Schaffen Sie klare Verhältnisse, und regeln Sie alles schriftlich
Egal für welche Option Sie sich entscheiden, es ist wichtig, klare Verhältnisse zu schaffen und alles schriftlich und möglichst konkret zu regeln. Die Musterverträge der FMH (Arbeitsverträge, Gesellschaftsverträge, Praxisübernahmeverträge usw.) bieten eine gute Basis für die Verhandlungen und dienen als Orientierungshilfe. Diese müssen aber unbedingt an Ihre Verhältnisse angepasst werden und von Vorteil durch eine externe Stelle wie einen Rechtsanwalt oder die FMH Consulting Services geprüft werden. Bei den Verhandlungen treffen sich mehrere Parteien mit unterschiedlichen Vorstellungen, Erfahrungen und Bedürfnissen. Eine erfahrene Beraterin / ein erfahrener Berater kann zwischen den Parteien vermitteln, auf mögliche Probleme hinweisen, den Vertragspartnern gängige und erprobte Lösungsansätze aufzeigen, auf wichtige Voraussetzungen hinweisen, das Protokoll der Verhandlung führen sowie Ziele für das weitere Vorgehen setzen.
-> Sorgfältig ausdiskutierte Verträge, nachvollziehbare Konditionen und klar definierte Termine sind die Voraussetzung für eine angenehme und erfolgversprechende Zusammenarbeit.
Dies sind erst die wichtigsten Tipps. Es gibt aber noch viel mehr zu berücksichtigen...
Fazit: Lassen Sie sich beraten!
Als Unternehmerin/Unternehmer sollten Sie nicht nur eine gute Medizinerin / ein guter Mediziner sein, sondern auch Manager/in, HR-Fachmann/-Fachfrau, Marketingspezialist/in, IT-Spezialist/in, Betriebswirtschafter/in, Jurist/in, Vorsorgespezialist/in und nicht zuletzt ein Versicherungsfachmann/-Fachfrau. Es ist jedoch weder sinnvoll noch wünschenswert, alles selber zu machen. Eine gute Unternehmerin / ein guter Unternehmer hat die Projektleitung in ihrem/seinem Unternehmen und zieht bei Bedarf Spezialisten/-innen bei.
-> Vermeiden Sie unnötige Fehler, gehen Sie mit Ihrer Freizeit sorgfältig um, und lassen Sie sich beraten.
Rechtliche Bestimmungen zur Ärztehaftung
In der Schweizer Rechtsordnung bestehen keine speziellen Regelungen bezüglich der ärztlichen Haftpflicht oder eines Behandlungsvertrages. Hier kommen die allgemeinen Haftpflichtbestimmungen zum Tragen. Grundsätzlich kann zwischen einer vertraglichen und ausservertraglichen Haftpflicht unterschieden werden. Die Unterschiede möchten wir in diesem Beitrag kurz vorstellen.
Mit einer Behandlung entsteht grundsätzlich eine vertragliche Beziehung zwischen dem Arzt sowie dem Patienten. Je nachdem, ob der Arzt in einer Privatklinik, einer eigenen Praxis oder in einem öffentlich-rechtlichen Spital tätig ist, untersteht dieses Rechtsverhältnis privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Haftungsnormen. Im privatrechtlichen Bereich gilt ein Behandlungsvertrag als Auftragsverhältnis im Sinne des Obligationenrechts (OR Art. 394ff). Während ein Patient die vertragliche Pflicht zur Zahlung der Behandlungskosten übernimmt, muss ein Arzt die sorgfältige Untersuchung und Behandlung sicherstellen. Der Arzt steht nicht nur für sein persönliches Verhalten ein, sondern auch für die von ihm beigezogenen Drittpersonen wie beispielsweise eine medizinische Praxisassistentin. Ein Heilungserfolg ist hingegen nicht geschuldet.
Vertragliche Haftung
Sofern ein Patient durch die Behandlung geschädigt wird, kann dieser den Arzt für den Schaden haftbar machen. Bei der vertraglichen Haftung muss der Geschädigte einerseits das Vorhandensein eines Schadens beweisen. Andererseits muss eine Vertragsverletzung vorliegen, wobei hier in der Regel von einer Verletzung der Sorgfaltspflicht oder Aufklärungspflicht ausgegangen wird. Ein zentraler Unterschied der vertraglichen Haftung gegenüber einer ausservertraglichen Haftung liegt in der Schuldfrage, da von einer Schuld des Arztes ausgegangen wird. Der Geschädigte muss somit den Schuldbeweis nicht erbringen und die Beweislast liegt beim Arzt. Dieser muss demnach darlegen können, dass er seine Sorgfaltspflicht oder Aufklärungspflicht umfassend erfüllt hat.
Pflichtverletzung
Was wird aber eigentlich unter einer Pflichtverletzung verstanden? Nicht jede ärztliche Handlung oder Unterlassung, die nachträglich betrachtet ein Schaden verursacht hatte oder vermieden hätte, ist automatisch eine Pflichtverletzung. Eine Pflichtverletzung ist nur dann juristisch relevant, wenn ein ärztliches Vorgehen nach allgemeinem fachlichem Wissensstand nicht als vertretbar erscheint und damit ausserhalb der objektiven ärztlichen Kunst steht.
Wer ist Vertragspartei?
An dieser Stelle stellt sich zudem die Frage, wer überhaupt Vertragspartei eines Behandlungsvertrages ist. Vereinfacht gesagt ist neben dem Patienten der Rechnungssteller Vertragspartei. Ein selbständigerwerbender Arzt, der über seine Abrechnungsnummer Rechnung stellt, ist somit klar Vertragspartei. Auch klar ist, wenn die Behandlung in einem Spital durch einen angestellten Arzt erfolgt, jedoch das Spital Rechnung stellt und dadurch Vertragspartei wird.
Nicht immer ist die Situation aber derart klar. Bei Gemeinschaftspraxen stellt sich beispielsweise die Frage, ob die einzelnen Ärzte über eigene Abrechnungsnummern verfügen oder ob eine Abrechnung über eine juristische Person erfolgt. Auch in Spitälern werden oft Mischformen beobachtet. Beispielsweise kann ein Spital für die Nutzung der Infrastruktur und Hotellerie Rechnung stellen, während ein Belegarzt für die eigentliche Behandlung selbst Rechnung stellt.
Ausservertragliche Haftung
Nebst der vertraglichen Haftung könnte ein Patient seine Ansprüche auch nach den Grundsätzen der ausservertraglichen Haftung geltend machen. Die Rechtsgrundlage liefert hier das Obligationenrecht mit Artikel 41 bezüglich unerlaubter Handlung. Nebst einem Schaden und einer widerrechtlichen Handlung, muss hier auch ein schuldhaftes Verhalten bewiesen werden. Und hier liegt der wesentliche Unterschied zur vertraglichen Haftung. Das Erbringen dieses Schuldbeweises ist oft nicht einfach und die Geltendmachung einer Forderung für den Geschädigten über die vertragliche Haftung deshalb stets vorteilhaft. In der Praxis ist es darum so, dass Haftpflichtansprüche eigentlich immer aufgrund der vertraglichen Haftung geltend gemacht werden.
Haftpflichtversicherung
Bei aller Sorgfalt kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Patient geschädigt wird und Ansprüche geltend macht. Eine Berufshaftpflichtversicherung schützt Sie gegen die finanziellen Folgen. Nebst der Deckung eines berechtigten Anspruchs, unterstützt die Versicherungen vor allem auch in der Abwehr ungerechtfertigter Forderungen. Dabei hilft sie beispielsweise im Erbringen der notwendigen Entlastungsbeweise. Wie vorgängig erwähnt muss geklärt werden, wer Vertragspartie des Behandlungsvertrages ist. Diejenige Partei muss auch die notwendige Berufshaftpflichtversicherung bestellen, um im Schadenfall gedeckt zu sein. Nebst attraktiven Rahmenvertragsangeboten von spezialisierten Versicherungsunternehmen stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Roth Gygax & Partner AG*
Moosstrasse 2
3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00
mail[at]fmhinsurance.ch
www.fmhinsurance.ch
*Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Mehrwertsteuergesetz 2025: Diese Änderungen kommen definitiv
Nach langer Vorbereitungszeit tritt die MWSTG-Revision in Kraft. Die teilrevidierte MWSTV enthält einerseits die Ausführungsbestimmungen zum geänderten MWSTG und andererseits davon unabhängige Anpassungen wie z. B. Saldo- und Pauschalsteuersatzmethode.
Änderungen beim Saldosteuersatz in der MWST-Verordnung
- Die 50 %-Regel für Mischbranchen fällt weg.
- Es können mehr als zwei Saldosteuersätze angewendet werden. Die 10 %-Regel bleibt jedoch bestehen.
- Eine Änderung der Abrechnungsart muss als Nutzungsänderung abgerechnet werden.
Die Möglichkeit, neu alle zehn Saldosteuersätze nebeneinander anzuwenden, ist grundsätzlich zu begrüssen, wobei die Beibehaltung der 10 %-Regel eine Hürde darstellt.
Die „Betroffenheit“ der Ärzteschaft ist unterschiedlich: Die Breite von Betroffenheit reicht von gar nicht (Arzt ohne Selbstdispensation oder Umsatz unter 100’000) über etwas (Arzt mit Selbstdispensation mit Umsatz über 100'000) bis zu eher stark betroffen (Arzt mit Selbstmedikation mit Umsatz über 100'000 + Abgabe von Hilfsmitteln (z. B. Orthopädische Praxen)).
Die Änderungen bei den Saldosätzen führen zu einer Anpassung bei der Leistungserfassung sowie allenfalls des Kontenplanes, denn die Umsätze müssen leistungsspezifisch erfasst und den Steuersätzen zugeordnet werden können.
Steuerpflichtige Praxen im Gesundheitsbereich (steuerbarer Jahresumsatz > CHF 100‘000), deren steuerpflichtige Umsätze aus verschiedenen Leistungen resultieren, müssen nun jede Leistungskategorie analysieren und separat verbuchen. So folgen Logistikdienstleistungen einem anderen Saldosteuersatz als der Medikamentenverkauf und der Verkauf orthopädischer Hilfsmittel ist wiederum mit einem anderen Saldosteuersatz abzurechnen. Eine Überprüfung drängt sich dann auch vor allem bei steuerpflichtigen Praxen auf, welche von der Mischbranchenregelung Gebrauch gemacht haben.
Wegfall der Mischbranchenregelung
Für die Gesundheitsbranche stellte die Anwendung von bloss einem Saldosteuersatz bisher eine wesentliche Vereinfachung dar. Mehrere Saldosteuersätze nebeneinander anwenden zu müssen bedeutet, dass neu die steuerbaren Erträge bei der Leistungserfassung detaillierter erfasst werden müssen. Von der Erhöhung des Saldosteuersatzes wird die Gesundheitsbranche nicht direkt betroffen sein. Der Medikamentenverkauf (Einkauf zu 2.6 %) ist auch in Zukunft mit 0.6 % Saldosteuersatz (SSS) abzurechnen. Die Lieferung von Gegenständen (Einkauf zu 8.1 %), welche bisher ebenfalls unter den Mischbranchensatz fiel, muss 2025 ab einem Umsatzanteil der steuerbaren Umsätze von mehr als 10 % mit dem SSS von 2.1 % erfasst werden.
Nutzungsänderungen
Bisher hatte der Wechsel von der effektiven zur Saldosteuersatzmethode und umgekehrt grundsätzlich keine steuerlichen Korrekturen auf Warenlagern und dem Anlagevermögen zur Folge. Neu ergeben sich bei solchen Wechseln Nutzungsänderungen mit Vorsteuerkorrektur (Eigenverbrauch) oder mit nachträglichem Vorsteuerabzug (Einlageentsteuerung). Eine Regelung, die in ähnlicher Form schon unter dem alten, bis Ende 2009 gültigen MWSTG bestand, dann aber aufgehoben wurde.
Wenn also ab 2025 eine Praxis die Abrechnungsart wechselt von effektiv zum Saldosteuersatz muss geprüft werden, ob Assets mit getätigtem Vorsteuerabzug neu unter der Saldosteuersatzmethode erfasst werden, was eine Rückzahlungspflicht (Eigenverbrauch) auslöst. Umgekehrt entsteht ein nachträgliches Vorsteuerabzugsrecht (Einlageentsteuerung).
Jährliche Abrechnungsperiode
Steuerpflichtige mit einem Umsatz von nicht mehr als CHF 5’005’000 pro Jahr aus steuerbaren Leistungen erhalten inskünftig die Möglichkeit, auf Antrag ihre MWST jährlich abzurechnen. Die Anwendung der jährlichen Abrechnung ändert nichts an der Abrechnungsmethode. Auch bei der jährlichen Abrechnung wird also entweder effektiv oder – wenn eine entsprechende Bewilligung vorliegt – mit Saldosteuersätzen oder Pauschalsteuersätzen abgerechnet.
Bei der jährlichen Abrechnung wird von der ESTV ein provisorischer Steuerbezug mittels Raten festgelegt und viertel- oder halbjährlich (je nach Abrechnungsmethode) in Rechnung gestellt. Massgebend für die Festlegung der Raten ist die Steuerforderung der letzten Steuerperiode. Ist sie noch nicht bekannt, so wird sie von der ESTV geschätzt. Bei neu steuerpflichtigen Personen ist die bis zum Ende der ersten Steuerperiode erwartete Steuerforderung massgebend. Somit erfolgt zwar die Abrechnung nur einmal im Jahr, aber die Zahlungen erfolgen weiterhin viertel- oder halbjährlich.
Risiken bei Infrastrukturnutzung und Gruppenpraxen
Die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur oder Personal und Aufteilung von Kosten von Gruppenpraxen sind gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 6 MWSTG Dienstleistungen, welche grundsätzlich von der Mehrwertsteuer ausgenommen sind, soweit es beim Zusammenschluss um einzelne Ärztinnen oder Ärzte im Rahmen einer einfachen Gesellschaft handelte. Mit der Publikation vom 9. Mai 2023 veröffentlichte die ESTV eine Praxisfestlegung, bei der die Ausnahme auch bei juristischen Gesellschaftern bestehen bleibt, soweit es sich um „Einpersonengesellschaften“ handelt (gemäss Art. 21 Abs. 3 lit. c MWST-Branchen-Info-21 Gesundheitswesen). Das bedeutet, dass für Praxisgesellschaften in Form juristischer Personen (z. B. GmbH oder AG) und Personengesellschaften (Kommandit- oder Kollektivgesellschaften) diese Mehrwertsteuer-Ausnahme weiterhin nicht gilt.
Die Wahl der rechtlichen Organisationsform ist von strategischer Bedeutung für die Zukunft einer unternehmerischen Tätigkeit und solche konzeptionellen Entscheidungen sollten zusammen mit der Treuhandberatung von langer Hand geplant werden.
Erweiterung der Steuerausnahmen
- Mit der Revision wurden weitere Leistungen von der Mehrwertsteuerpflicht ausgenommen.
Die neue Ziffer 3bis von Art. 21 Abs. 2 MWSTG nimmt im Gesundheitsbereich die sogenannten Managed-Care Leistungen (Leistungen der koordinierten Versorgung im Zusammenhang mit Heilbehandlungen bzw. integrierte Versorgung von Patientinnen und Patienten) von der Steuer aus.
Diese Änderung bedeutet, dass solche gesetzlich auferlegte administrative Koordinationsdienstleistungen ab 1.1.2025 nicht mehr steuerpflichtigen Umsatz darstellen. - Neu können Ambulatorien und Tageskliniken den Belegärzten Infrastrukturleistungen ohne MWST-Belastung zur Verfügung stellen (Art. 21 Abs. 2 Ziff. 2 MWSTG). Abzuwarten ist, inwieweit diese Ausnahme auch auf weitere medizinische Zentren und deren Logistikdienstleistungen angewendet werden kann.
- Art. 21 Abs. 2 Ziff. 8 MWSTG gilt in Bezug auf Organisationen der Krankenpflege und der Hilfe zu Hause (Spitex) neu auch für nicht gemeinnützige Organisationen. Damit sind diesbezüglich weiterführende Leistungen als ärztlich verordnete Pflegeleistungen neu auch von der Steuer ausgenommen, wenn sie von privaten, in der Regel gewinnstrebigen und nicht gemeinnützigen Organisationen, erbracht werden.
Tücken im Bereich ästhetischen/präventiven Medizin
Die bisherige eindeutige Praxis, publiziert in der Branchenbroschüre Nr. 21, wonach Untersuchungen, Beratungen und Behandlungen, die der Hebung des Wohlbefindens oder der Leistungsfähigkeit dienen oder aus ästhetischen Gründen vorgenommen werden, sofern sie vom Arzt oder von der Ärztin selbst erbracht werden (Art. 34 Abs. 3 Bst. a MWSTV), als von der Steuerpflicht ausgenommen zu behandeln sind, wird von der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) in Frage gestellt werden. Im Fokus der ESTV sind Eingriffe, die in keinem Zusammenhang mit Gesundheit und Heilung einer Krankheit stehen. Wie die Abgrenzungen vorzunehmen sein werden, ist aktuell auch für die ESTV unklar. Im Vordergrund steht die mehrwertsteuerliche Qualifikation anhand der Beurteilung des konkreten Eingriffes.
Es empfiehlt sich, die Praxisentscheidungen und Publikationen der ESTV zu diesem Thema im Auge zu behalten, denn erst dann kann die Handhabung im Bereich Mehrwertsteuer für die Praxen fixiert werden.
Fazit
Die Revision des Mehrwertsteuergesetzes bringt für Saldosteuersatz abrechnende Unternehmungen diverse Nachteile und Mehraufwendungen (Nutzungsänderung, Umsatzerfassung etc.) mit sich. Einige Mehraufwendungen sind einmaliger Natur, während andere künftig regelmässig anfallen werden. In beiden Fällen ist eine gute Vorbereitung das A und O.
Die Ausweitung der Steuerausnahmen ist zu begrüssen, wobei die weiterhin bestehenden Restriktionen gegenüber juristischen Personen nicht nachvollziehbar sind.
Die Praxis der ESTV muss also auch in Zukunft im Auge behalten werden, damit der Handlungsbedarf rechtzeitig erkannt wird und böse Überraschungen vermieden werden können.
Eidg. dipl. Treuhandexperte
fmhjob.ch: Recruiting in Zeiten des Fachkräftemangels
Kluge Köpfe dort suchen und finden, wo die Trefferquote am höchsten ist. Spezialisierte Stellenportale gibt es mehrere, was die Frage aufwirft, welches die besten Erfolgsaussichten bietet. Zusätzlich entstehen durch die Schaltung von Inseraten Kosten, die angesichts der zweiten grossen Herausforderung im Gesundheitswesen ebenfalls sorgfältig berücksichtigt werden müssen. Die Frage darf wohl momentan so beantwortet werden: fmhjob.ch ist die führende Schweizer Plattform im Gesundheitswesen für Stellen und Praxen. Die Aussage lässt sich damit stützen, dass viele Stellenvermittler im Gesundheitswesen immer wieder mit dieser Plattform arbeiten. Mit fmhjob.ch bietet sich für Kliniken, Praxen und Gesundheitszentren die Möglichkeit, einfach, kostengünstig und schnell Stellenangebote für Ärztinnen und Ärzte sowie für medizinisches Personal zu veröffentlichen. Weiter gibt es einfache Möglichkeiten, die Präsenz zu erhöhen. Mittels eines Logoplatzes auf der Startseite oder Promotionen kann die Erhöhung der Reichweite und Bewerbung des Unternehmens gefördert werden. Durch direkte Verlinkung auf die eigene Bewerbungsplattform kann der Rekrutierungsprozess beschleunigt und vereinfacht werden und die Präsenz auf der eigenen Plattform erhöht werden.
Einfacher Zugang, schnelles Auffinden, faire Preise, verlässliche Qualität
Beim Inserat spielt neben dem Jobinhalt auch die Qualität eine Rolle. Daher werden alle Inserate durch das Team von fmhjob.ch sorgfältig geprüft. Die Kosten lassen sich mit Insertionskosten ab CHF 195 unter Kontrolle halten. Längere Laufzeiten sind mit attraktiven Rabatten verbunden. Die bestehenden Kunden wissen das zu schätzen, wie z. B. Frau Erika Steiner, HR-Beraterin/Stv. Leiterin HR, Triaplus AG: «Die Stellenplattform fmhjob.ch nutzen wir seit Jahren regelmässig zur erfolgreichen Unterstüzung im Rekrutierungsprozess und als Werbeplattform für unsere Klinik. Besonders schätzen wir die persönliche Betreuung, die uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht.» Herr Serge Wilhelm, Leiter Personal und Finanzen, Stv. Spitaldirektor Zuger Kantonsspital AG, doppelt nach: «fmhjob.ch unterstützt uns zielgerichtet bei der Besetzung von medizinischem Fach- und Kaderpersonal. Die Plattform zeichnet sich durch Effizienz und Kosteneffektivität aus und wird von einem erfahrenen und professionellen Team betreut.» Der Zugang und das Aufsetzen eines Inserates sind einfach und schnell erledigt und bestehende eigene Inserate können blitzschnell in die Plattform integriert werden. Für die Suchenden gibt es viele Filtermöglichkeiten damit die gewünschte Stelle schnell gefunde wird. Weiter kann ein Suchabo eingerichtet werden.
Immer wieder profitieren – auch in Kombination mit persönlicher Beratungsexpertise
Zahlreiche HR-Verantwortliche und Praxisinhaber/innen bauen ebenfalls auf fmhjob.ch, und das seit Langem. Zudem sind viele Stellensuchende auf der Plattform und werden durch das angesprochene Suchabo auch auf neue Stellen aufmerksam gemacht. Dies kann auf der eigenen Website meistens nicht abonniert werden. Das gleiche gilt auch für ärztliches, pflegerisches und therapeutisches Fachpersonal, das nach einer neuen Herausforderung Ausschau hält. Zudem treffen sich auch Praxisinhaber/innen, die eine Nachfolge suchen, oder Praxisgründer/innen, die sich für eine Übernahme interessieren. «Aufgrund des sorgfältig gepflegten Netzwerks ist die Erfolgsquote für jede Fragestellung gross», freut sich Claudine Achermann. «Darüber hinaus bieten wir sämtlichen Gesundheitsinstitutionen auch dank unserer Beratungsexpertise mit FMH Services die Möglichkeit, Stellenbesetzungen auf Mandatsbasis zu übernehmen. Indem bei FMH Services eine Datenbank von mehr als 41 000 Kontaktdaten zu Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz wie auch Kontakte zu ausund inländischen Vermittlungsagenturen besteht, kann auf viele potentielle Stellensuchende zugegangen werden. Für Ärztinnen und Ärzte, die eine berufliche Veränderung anstreben, stehen wir mit unserer Karriere- und Vertragsberatung zur Verfügung. Diese Dienstleistungen sind in unserem Bereich Health Services bewährt und sehr geschätzt.»
Einander erfolgreich begegnen
Suchende und Inserierende können sich nur dann erfolgreich begegnen, wenn sie gleichzeitig auf derselben Plattform präsent sind. Daher reicht es heutzutage nicht mehr aus, Stellenangebote lediglich auf der Website zu veröffentlichen. Stellenportale bieten eine deutlich grössere Reichweite und sind daher unverzichtbar. Eine Plattform wie fmhjob.ch, die zusätzlich persönliche Beratung bietet, stellt eine ideale Unterstützung für Anbietende und Suchende im Gesundheitswesen dar, um effektiv zueinander zu finden.
Mitglied der Geschäftsleitung
Revidiertes Aktienrecht, die Uhr tickt
Seit dem 1. Januar 2023 gelten die Bestimmungen des revidierten Aktienrechts. Diese sind nicht nur für die Aktiengesellschaft, sondern zu einem grossen Teil auch für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und die Genossenschaft anwendbar. Die Übergangsfrist für die statu-tarischen Anpassungen läuft am 31.12.2024 ab. Haben Sie Ihre Hausaufgaben schon gemacht?
Die Anpassungen beim revidierten Aktienrecht
Damit die gesetzlichen Neuerungen zur Anwendung kommen, müssen diese in den Statuten der Gesellschaft berücksichtigt werden. Aus diesem Grund gilt es die Statuten bis spätestens am 31. Dezember 2024 anzupassen.
Ich fasse kurz die wesentlichen Änderungen für die Arztpraxis zusammen:
- Stichentscheid des Vorsitzenden an der Generalversammlung (GV): Soll der Vorsitzende keinen Stichentscheid haben, muss das in den Statuten festgehalten werden.
- Ausschüttung von Zwischendividenden: Gestützt auf einen Zwischenabschluss kann die GV die Ausschüttung einer Zwischendividende beschliessen.
- Statuarische Schiedsklauseln: Die Statuten können vorsehen, dass gesellschaftsrechtliche Strei-tigkeiten durch ein Schiedsgericht mit Sitz in der Schweiz beurteilt werden. Die Schiedsklausel bindet die Gesellschaft, die Organe und die Mitglieder der Organe sowie die Aktionäre, wenn die Statuten es nicht anders bestimmen.
- Stärkung des Auskunfts- und Einsichtsrechts des Aktionärs: z. B. können die Geschäftsbücher und die Akten von Aktionären eingesehen werden, die zusammen mindestens fünf Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten. Der Verwaltungsrat (VR) gewährt die Einsicht innert vier Monaten nach Eingang der Anfrage.
Anpassungen
Wir empfehlen für Arztpraxen, welche als Gesellschaft (AG, GmbH oder Genossenschaft) firmiert sind und zwei oder mehrere Eigentümer beteiligt sind, die Änderungen zu prüfen und in die neuen Statuten einzupflegen, damit diese von den einzelnen Vorschriften profitieren können.
Verpflichtung für die ordnungsgemässe Führung der Gesellschafter-Verzeichnisse
Die Gesellschaften haben Register über ihre Gesellschafter ordnungsgemäss zu führen, in denen die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adressen eingetragen werden. Die Eintragung erfolgt erst wenn der Erwerb, bzw. das Recht nachgewiesen wird. Das Register muss so geführt werden, dass ein Zugriff darauf jederzeit möglich ist.
Das Gesellschafter-Verzeichnis heisst bei der Aktiengesellschaft das Aktienbuch über die Aktionäre und Nutzniesser (Art. 686 OR), bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist es das Anteilbuch über die Gesellschafter, Nutzniesser und zusätzlich die Pfandgläubiger (Art. 790 OR), bei der Genos-senschaft ist es das Genossenschafter Verzeichnis über die Genossenschafter (Art. 837 OR).
Anpassungen
Die Verwaltung der Gesellschaft muss sicherstellen, dass die Verzeichnisse digital und/oder phy-sisch abgelegt sind, ein Zugriff jederzeit möglich ist. Die Änderungen in den Verzeichnissen müssen bei einem Eigentümerwechsel sofort und vollständig nachgeführt werden.
Durchführung der Generalversammlung (GV)
Die GV kann seit der Revision folgendermassen abgehalten werden:
- Schriftliche GV: Die GV kann ihre Beschlüsse schriftlich oder in elektronischer Form fassen.
- Virtuelle GV: Die GV kann mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden.
- GV mit «direct voting»: Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass Aktionäre, die nicht am Ort der GV anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg ausüben können.
- GV an mehreren Tagungsorten: Die GV kann an mehreren Orten gleichzeitig durchgeführt werden.
- GV im Ausland: Die GV kann auch im Ausland durchgeführt werden.
Anpassungen
Diese Erleichterungen für die Durchführung der GV sind für Arztpraxen sinnvoll, wenn diese als Gesellschaft firmiert sind und mehrere Eigentümer haben. Um davon profitieren zu können, müs-sen die genannten erweiterten Möglichkeiten in den Statuten beinhaltet sein. Damit ist eine Gesell-schaft schnell und unkompliziert handlungsfähig, z.B. bei einem längeren Auslandsaufenthalt eines Eigentümers. Mit den Vorschriften über unterschiedliche Tagungsorte, wie auch über die virtuelle GV, kann diese unkompliziert stattfinden und jeder Eigentümer, auch wenn er nicht in der Praxis vor Ort ist, kann seine Teilnahme- und Mitwirkungsrechte ausüben. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wo eine qualifizierte Mehrheit (z. B. 2/3 Mehr) für ein Rechtsgeschäft erforderlich ist.
Anpassung der Kapitalvorschriften
- Aktienkapital in Fremdwährung: das Aktienkapital kann neu in einer Fremdwährung geführt werden, wenn dies für die Geschäftstätigkeit notwendig ist. Als Fremdwährungen zugelassen sind EUR, GBP, USD und der YEN
- Kapitalband: Die GV kann den Verwaltungsrat ermächtigen, das Kapital während einer be-stimmten Zeitspanne innerhalb einer bestimmten Breite beliebig zu erhöhen oder herabzuset-zen.
Anpassungen
Diese Bestimmungen sind dann dienlich, wenn eine Arztpraxis schnell expandieren möchte mit zusätzlichen Eigentümern, diese nicht den etwas komplexeren Weg über eine Kapitalerhöhung gehen möchten und natürlich die bestehenden Eigentümer ihre bisherigen Beteiligungen behalten möchten. Die Bestimmungen betreffend des Aktienkapitals in einer Fremdwährung sind voraus-sichtlich in der Praxis weniger relevant.
Übergangsrecht
Gesellschaften, die den neuen Vorschriften nicht entsprechen, müssen innerhalb von zwei Jahren, somit bis zum 31. Dezember 2024, ihre Statuten und Reglemente den neuen Bestimmungen anpas-sen.
Wir empfehlen Ihnen die Anpassungen so schnell wie möglich vorzunehmen und helfen Ihnen ger-ne bei der Überprüfung der Statuten und Reglemente.
Marc Renggli
Consultant
lic.iur. / Rechtsanwalt
Schutz vor Social Engineering und Social Hacking
In einer zunehmend digitalisierten Welt sind Ärzte und deren Praxen vermehrt auf die Verfügbarkeit von digitalen Daten und Systemen angewiesen. Gleichzeitig steigt die Gefahr von Cyberangriffen stetig. Ein Bereich, der dabei oft unterschätzt wird, ist das sogenannte Social Engineering und Social Hacking. Dabei nutzt der Angreifer gezielt menschliche Schwächen aus, um an sensible Informationen zu gelangen. Dieser Artikel wirft einen Blick auf dieses Thema und zeigt auf, wie Sie sich gegen die Folgen schützen können.
Was ist Social Engineering und Social Hacking?
Social Engineering bezeichnet die Manipulation von Menschen, um sie dazu zu bringen, vertrauliche Informationen preiszugeben oder bestimmte Handlungen auszuführen, die für den Angreifer von Vorteil sind. Dies kann beispielsweise durch Phishing-E-Mails, gefälschte Anrufe oder Social-Media-Interaktionen geschehen. Social Hacking hingegen bezieht sich auf den Missbrauch sozialer Interaktionen, um Zugang zu Systemen oder sensiblen Daten zu erlangen, sei es durch Manipulation, Täuschung oder direkte Einflussnahme.
Die Gefahren für Arztpraxen
Für Arztpraxen sind Social Engineering und Social Hacking besonders bedrohlich, da sie über sensible Patientendaten und vertrauliche Informationen verfügen. Ein erfolgreicher Angriff kann nicht nur zu Datenlecks führen, sondern auch das Vertrauen der Patienten erschüttern und den Ruf der Praxis und des Arztes schwer beschädigen. Darüber hinaus können finanzielle Verluste durch Betrug oder Erpressung entstehen.
Die Rolle von Cyberversicherungen
Cyberversicherungen spielen eine wichtige Rolle beim Schutz vor den Folgen von Cyberangriffen. Einerseits bietet die Versicherung einen finanziellen Schutz im Falle eines Cyberereignisses. Andererseits bieten die Cyberversicherungen auch verschiedene Dienstleistungen im Schadenfall wie eine 24-Stunden Hotline und forensische Untersuchungen oder aber auch in der Schadenprävention.
Umfang des Versicherungsschutzes
Unsere Cyberversicherung, welche speziell auf die Bedürfnisse der Ärzteschaft ausgerichtet ist, deckt sowohl Eigenschäden wie auch Haftpflichtschäden. Unter Eigenschäden sind beispielsweise die Kosten für Wiederherstellung des Systems nach einem Angriff abgedeckt. Weiter übernimmt die Versicherung auch den Ertragsausfall, wenn eine Arztpraxis geschlossen bleiben muss, weil zum Beispiel kein Zugriff auf die Patientendossiers vorhanden ist. Unter Haftpflichtschäden versteht man Ansprüche Dritter, wenn beispielsweise kein Zugriff mehr auf einen Laborbefund besteht und dieser deshalb nochmals gemacht werden muss oder Schäden infolge Datenschutzverletzungen. Nebst der Grunddeckung kann Social Engineering und Social Hacking gegen eine Mehrprämie mitversichert werden. Zudem sind auch Manipulationen am E-Banking oder an der Telefonanlage versicherbar und die Zahlung von Lösegeldforderungen ist optional wählbar.
Präventionsservice
Neben dem Versicherungsschutz ist es entscheidend, präventive Massnahmen zu ergreifen, um sich gegen Social Engineering-Angriffe zu wappnen. Deshalb beinhaltet unsere Ärzte-Cyberversicherung einen kostenlosen Präventionsservice. Damit können Arztpraxen ihr Personal schulen und sensibilisieren, um das Bewusstsein für Cybersicherheit zu erhöhen. Zudem umfasst der Präventionsservice verschiedene Tipps, um die Systemsicherheit zu erhöhen.
Fazit
Social Engineering und Social Hacking stellen ernsthafte Bedrohungen für Arztpraxen dar, da sie menschliche Schwächen ausnutzen, um Zugang zu sensiblen Informationen zu erlangen. Cyberversicherungen spielen eine wichtige Rolle beim Schutz vor den finanziellen Folgen solcher Angriffe und bieten die Sicherheit und den Schutz, den Sie benötigen, um ihre Patientendaten und ihren Ruf zu schützen. Durch präventive Massnahmen und Schulungen können Sie zusätzlich dazu beitragen, sich gegen Social Engineering-Angriffe zu verteidigen und ihre Cybersicherheit zu stärken.
Praxisbeispiel Social Engineering
Eine Frau ruft eine Arztpraxis an, um einen Termin für eine Vorstellung einer neuen Softwarelösung zu vereinbaren. Die Praxisassistentin Anna lehnt ab, da sie mit der eigesetzten Software sehr zufrieden ist. Beim Verabschieden erkundigt sich die Frau interessenhalber, welche Lösung denn eingesetzt werde. Einige Wochen später ruft ein Mann namens Martin die gleiche Arztpraxis an. Er behauptet, dass es ein dringendes Sicherheitsupdate für die verwendete Praxissoftware gibt und dass er persönlich vorbeikommen müsse, um es zu installieren. Martin weiss, welche Softwarelösung die Arztpraxis einsetzt und auch die Nummer, welche im Display von Anna angezeigt wird, passt zur Softwarefirma. Martin erzählt, dass das Update schnell installiert werden müsse um kritische Schwachstellen zu beheben und sensible Patientendaten zu schützen. Anna ist besorgt über die Sicherheit der Patientendaten und nimmt Martins Anruf ernst. Sie hat zwar von ihrem Vorgesetzten, welcher an einem Kongress weilt, keine spezifischen Anweisungen erhalten, will die Sicherheit der Praxis aber gewährleisten und stimmt Martins Besuch zu. Noch am selben Tag erscheint Martin in der Praxis und wird von Anna freundlich begrüsst. Er trägt eine Jacke mit dem Logo des bekannten Softwareunternehmens und hat eine Tasche mit Laptop und verschiedenen Kabeln bei sich. Anna führt ihn zu einem freien Behandlungszimmer, in dem er seine Arbeit verrichten kann. Während Martin vorgibt, das Sicherheitsupdate zu installieren, nutzt er die Gelegenheit, um sich unauffällig Zugang zu den Computern und dem Netzwerk der Praxis zu verschaffen. Er installiert heimlich eine Remote-Zugriffssoftware, die es ihm ermöglicht, später von extern auf die Systeme zuzugreifen. Nachdem Martin sein angebliches Update abgeschlossen hat, bedankt er sich bei Anna und verlässt die Praxis. Anna, erleichtert
über die Installation des Updates, geht zurück an ihren Arbeitsplatz und geht davon aus, dass die Patientendaten jetzt sicher sind. Was Anna zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnt, ist dass die Angreifertruppe bereits mit dem Datendiebstahl der Patientenakten begonnen hat. Zwei Tage später geht eine Erpresserforderung im E-Mail Postfach ein. Überweist die Praxis innerhalb von 48 Stunden die Lösegeldforderung nicht, werden die Patientendaten im Darknet veröffentlicht. Zum Beweis sind einige Patientenakten dem E-Mail angefügt. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie Social Engineering auch in einer vertrauenswürdigen Umgebung wie einer Arztpraxis erfolgreich sein kann, wenn Mitarbeiter nicht ausreichend geschult sind oder die Bedeutung von Sicherheitsvorkehrungen unterschätzen.
Berufshaftpflichtversicherung für Praxisinhaber/innen
Zur Person
Roger Ledermann
Versicherungsfachmann, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Roth Gygax & Partner AG*
Moosstrasse 2
3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00
mail[at]fmhinsurance.ch
www.fmhinsurance.ch
*Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Vertrauen ist gut, Evaluation ist besser
In diesem Artikel bekommen Sie wertvolle Tipps für die Auswahl des richtigen Praxisinformationssystems. Wir betonen dabei einen oft übersehenen Aspekt im Evaluationsprozess: die Bestimmung konkreter Praxisfallbeispiele. Diese sind von entscheidender Bedeutung, um die Funktionen und Leistungsfähigkeit verschiedener Praxissoftwaresysteme objektiv miteinander zu vergleichen. Wir ermutigen Sie daher, die Anbieter in die Pflicht zu nehmen, Sie im Evaluationsprozess individuell zu begleiten.
Einführung: Die Wahl des richtigen Praxisinformationssystems
Bereits seit einigen Jahren dürfen wir die Schweizer Ärzteschaft im Auftrag der FMH Services bei Fragen rund um die Praxis-IT unterstützen. In diesem Artikel möchten wir Sie darüber informieren, was das «richtige» Praxisinformationssystem ausmacht und wie es inmitten der Vielzahl von Anbietern identifiziert werden kann.
Schlüssel zur richtigen Entscheidung: Eine strukturierte Evaluation
Eine strukturierte Evaluation bildet die Grundlage für eine nachhaltig richtige Entscheidung. Aus diesem Grund haben wir ein Fünf-Schritte-Modell zur Evaluierung von Praxissoftware für Sie entwickelt. Zusätzlich finden Sie in der Mitte des Softwarekatalogs einen umfassenden Kriterienkatalog, der Ihnen dabei hilft, relevante Unterscheidungsmerkmale von Softwarelösungen zu definieren.
Fallbeispiele aus der Praxis: Der oft vernachlässigte Faktor
Trotz zur Verfügung stehender Ressourcen stellen wir immer wieder fest, dass Ärztinnen und Ärzte einen entscheidenden Aspekt im Evaluationsprozess vernachlässigen, nämlich die Anwendung konkreter Fallbeispiele aus der Praxis zum Zweck der Evaluation. Denn was bringen Ihnen das Fünf-Schritte-Modell und ein ausgereifter Kriterienkatalog, wenn im Evaluationsprozess letztendlich Äpfel mit Birnen verglichen werden?
Die richtige Vorbereitung: Konzentration auf Kernaufgaben
Eine grundlegende Vorbereitungsmassnahme, die Sie treffen müssen, um eine objektive Vergleichbarkeit verschiedener Softwaresysteme sicherzustellen, besteht darin, im Vorfeld zwei bis drei phänotypische Fallbeispiele aus Ihrem Praxisalltag zu identifizieren. Nur anhand dieser konkreten Beispiele können Sie den Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Praxissoftwaresysteme wirklich kennenlernen.
Mangelnde Vorgaben: Eine Herausforderung im Evaluationsprozess
In der Regel erhalten die Anbieter keine klaren Vorgaben zur Präsentation, wodurch sie sich nicht individuell auf den Praxisbesuch vorbereiten können. Dies führt dazu, dass jeder Anbieter während der Präsentation Softwarefunktionen anhand fiktiver Beispiele vorführt. Meist haben diese generischen Beispiele, wie der Patient «Mustermann», wenig Bezug zu den realen Abläufen und Anforderungen Ihrer Praxis. Das Resultat sind beeindruckende, jedoch oberflächliche Einblicke in die Software. Ein umfassendes Verständnis der Kernfunktionen und eine tiefgehende Evaluierung der Softwareleistung bleiben dabei auf der Strecke. Zudem gestaltet sich ein sinnvoller Vergleich mehrerer Softwarelösungen nahezu unmöglich.
Verzicht auf komplexe Einzelfälle: Praxisnahe Beispiele im Evaluationsprozess
Es ist ratsam, bei der Auswahl der Fallbeispiele nicht zu stark auf komplexe Einzelfälle zu fokussieren, die in der Praxis nur selten vorkommen. Das Ziel ist es nicht, den Anbieter durch ausgefallene Szenarien auf die Probe zu stellen. Vielmehr sollten Sie Beispiele auswählen, die im täglichen Praxisbetrieb regelmässig auftreten. Eine erstklassige Praxissoftware sollte Sie effektiv und effizient in Ihren alltäglichen Kernprozessen und -aufgaben unterstützen. Dies umfasst die Administration, die Befundaufnahme, die Dokumentation sowie die Leistungserfassung und Abrechnung. Bedenken Sie, dass bereits 30 Sekunden Zeitersparnis pro Patient/ in durch die Nutzung der richtigen Praxissoftware zu einem erheblichen Effizienzgewinn führen kann. Dies kommt Ihnen und Ihren Patienten unmittelbar zugute.
Preis und Leistung: Ein ausgewogener Vergleich
Der Effizienzaspekt ist auch beim späteren Preisvergleich von Bedeutung. Die Preisspanne für Praxissoftware ist breit, jedoch ist der günstigste Anbieter nicht zwangsläufig der bessere, wenn die Software Ihnen nicht die entscheidenden Vorteile bietet. Daher sollten Sie die Leistungsfähigkeit immer im Verhältnis zum Preis betrachten und sicherstellen, dass die gewählte Software die Anforderungen an Ihren Praxisbetrieb bestmöglich erfüllt. Ein günstiger Kompromiss kostet Sie langfristig mehr als eine Lösung, die ihr Geld wert ist und wirklich zu Ihnen passt.
Transparenz bei den Kosten: Extrapolation und Vergleich
Im fortgeschrittenen Stadium des Evaluationsprozesses, wenn Sie mehrere gleichwertige Lösungsoptionen in Betracht ziehen, spielt natürlich auch der Preis eine entscheidende Rolle. Besonderes Augenmerk sollten Sie hierbei auf Zusatz- und Folgekosten legen, die beispielsweise durch Schnittstellen, Ergänzungsmodule und Wartungsverträge entstehen können. Bedauerlicherweise herrscht in der Branche nach wie vor eine gewisse Intransparenz bei den Preisen. Die Angebotsstrukturen variieren stark, und der Umfang der Leistungen in den einzelnen Verträgen kann erheblich differieren. Auch in dieser Hinsicht können Ihnen die Praxisfallbeispiele hilfreich sein. Sie ermöglichen es Ihnen, die Preis-Leistungs-Verhältnisse anhand Ihrer Patientenströme und typischen Fallkonstellationen einzuschätzen. Fordern Sie die Anbieter während des Angebotsprozesses dazu auf, eine transparente Gegenüberstellung von Preis und Leistung zu präsentieren, um eine objektive Grundlage für Ihre Entscheidung zu
schaffen.
Schlussfolgerung: Anbieter in die Pflicht nehmen
Sorgen Sie für eine angemessene Vorbereitung und zögern Sie keineswegs, in jeder Phase des Auswahlprozesses die Anbieter ausdrücklich darum zu bitten, Ihre individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Gewähren Sie den betreffenden Unternehmen jedoch auch ausreichend Zeit, sich angemessen darauf vorzubereiten. Der zusätzliche Aufwand mag auf beiden Seiten höher sein, doch auf lange Sicht zahlt er sich aus. Ein Anbieter, der Sie als langjährigen Kunden gewinnen will und die Mühen scheut, dem sollten Sie möglicherweise von Grund auf mit Skepsis gegenüberstehen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Auswahl Ihres neuen Praxisinformationssystems.
Sie haben Fragen? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite
Falls Sie bei der Auswahl und Evaluierung Ihres Praxisinformationssystems Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen auch im Jahr 2024 vertrauensvoll mit Rat und Tat zur Seite. Mit unserem Fachwissen und unserer langjährigen Erfahrung können wir Sie bei diesem wichtigen Schritt unterstützen. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Zur Person
Jakob Tiebel, Praxisberater
healthinal GmbH
Neue Jonastrasse 59
8640 Rapperswil-Jona
Telefon 055 534 68 11
jakob.tiebel@healthinal.com
www.healthinal.com
Factoring als Massnahme zur Überwachung der Zahlungsfähigkeit
Anfang 2023 trat das neue Aktienrecht in Kraft. Während sich der Art. 725 im Obligationenrecht bisher hauptsächlich auf die Pflichten des Verwaltungsrats (VR) bei Überschuldung und Kapitalverlust der Gesellschaft fokussierte, wird das Pflichtenheft des VR um die Überwachungspflicht der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft erweitert. Die Wahl von Factoring als Finanzierungsform bietet dem VR eine einfache Möglichkeit, den neuen Pflichten des Aktienrechts gerecht zu werden.
Herr Milankovic, welche relevanten Neuerungen sind mit dem neuen Aktienrecht per 01.01.2023 in Kraft getreten?
In der Medienmitteilung vom 23.11.2016 informierte der Bundesrat, dass eine Modernisierung des Aktienrechts vollzogen werden solle, welche unter anderem durch eine flexiblere Gestaltung der Gründungs- und Kapitalvorschriften erreicht werden sollte. Nach den parlamentarischen Beratungen wurde per 01.01.2023 eine Mehrheit der neuen Bestimmungen vom Bundesrat in Kraft gesetzt. Besonders interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Neuerung aus dem Art. 725 OR, welche direkte Auswirkungen auf die Pflichten des Verwaltungsrats hat. So hält der Gesetzgeber im Art. 725 OR Folgendes fest:
- Der Verwaltungsrat überwacht die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft.
- Droht die Gesellschaft zahlungsunfähig zu werden, so ergreift der Verwaltungsrat Massnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Er trifft, soweit erforderlich, weitere Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft oder beantragt der Generalversammlung solche, soweit sie in deren Zuständigkeit fallen. Er reicht nötigenfalls ein Gesuch um Nachlassstundung ein.
- Der Verwaltungsrat handelt mit der gebotenen Eile.
Während die Bestimmungen in Art. 725 OR bisher hauptsächlich die Bilanz im Fokus hatten, kommt mit der Komponente der drohenden Zahlungsunfähigkeit eine neue Überwachungs- und Kontrollfunktion für den VR hinzu.
Wie kann der VR nun der neuen Pflicht gerecht werden?
Um der neuen Pflicht der Überwachung der Zahlungsfähigkeit gerecht zu werden, muss sich der Verwaltungsrat überlegen, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt und über welchen Zeitraum hinweg er verlangt, um eine Beurteilung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft vornehmen zu können.
Auf welche Art und Weise der Verwaltungsrat diese Überwachungs- und Kontrollfunktion übernehmen soll, schreibt der Gesetzgeber nicht vor. Probate Mittel, welche hierfür eingesetzt werden können, sind beispielsweise Liquiditätskennzahlen oder -planungen, welche von einer einfachen tabellarischen Erfassung bis hin zu einer detaillierten Erfassung sämtlicher Geldströme reichen können. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Honorarabrechnung mit Factoring als Finanzierungsform zu kombinieren, bei welcher die Forderung an einen Abrechnungsdienstleister übertragen wird.
Wie kann die Honorarabrechnung mit Factoring als Massnahme zur Überwachung der Zahlungsfähigkeit eingesetzt werden?
Beim Verkauf der Forderung an einen Abrechnungsdienstleister erhält die Arztpraxis die Honorarsumme abzüglich einer Factoring-Gebühr sofort beim Verkauf der Forderung ausbezahlt. Durch das Factoring wird die Frist zwischen der Leistungserbringung und der Bezahlung der ausstehenden Forderung auf ein Minimum gesenkt, und die Liquidität steht unmittelbar zur Verfügung. Nebst der Sofortauszahlung der Forderungen deckt ein serviceorientierter Abrechnungsdienstleister weitere Dienstleistungen wie das Debitorenmanagement, die Absicherung des Debitorenverlustes sowie den gesamten Inkassoprozess ab, welche die Überwachung und Kontrolle der Zahlungsfähigkeit fördern und zur Risikominimierung in der Praxis führen. Verschiedenste Herausforderungen, welche die Zahlungsfähigkeit bedrohen können, treffen vermehrt auch die Arztpraxis. Sei dies eine weitere Pandemie, wie wir sie mit Covid-19 erlebt haben, oder die Rekrutierung von geeigneten Fachkräften, welche alle administrativen Arbeiten übernehmen können. Hinzu kommt, dass Krankenkassen in letzter Zeit die Kontrollen der Leistungsabrechnungen erheblich intensiviert haben, wodurch sich die Rückweisungen häufen und sich die Zahlungsfristen aufgrund von Rückfragen verlängern. Durch die Auslagerung des Debitorenmanagements an einen Abrechnungsdienstleister kann einerseits die Liquidität gesichert und gleichzeitig das unternehmerische Risiko reduziert werden.
Zur Person
Deni Milankovic
Leiter Finanzen & Zentrale Dienste
mediserv AG*
Neuengasse 5
2502 Biel/Bienne
Telefon 032 560 39 00
mail[at]fmhfactoring.ch
www.fmhfactoring.ch
*Die mediserv AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Factoringunternehmen.
So schützen Sie Ihre Praxis vor Cyberattacken
Im Rahmen der Digitalisierung nehmen Cyberattacken immer mehr zu. Dass sie jede und jeden treffen können – auch Arztpraxen und Institutionen des Gesundheitswesens –, ist leider eine Tatsache. Doch wer sich der Gefahr bewusst ist und sich entsprechend vorbereitet, ist Cyberkriminellen keinesfalls schutzlos ausgeliefert.
Im Jahr 2023 nahm die Zahl der in der Schweiz verübten Cyberattacken erneut zu. Das Gesundheitswesen mit seinen sensiblen, besonders schützenswerten Daten ist für Cyberkriminelle durchaus ein attraktives Ziel. Und da die Opfer dieser Angriffe oft eher zufällig als systematisch ausgewählt werden, kann es jede und jeden treffen.
Ransomware: Wenn Daten im Darknet auftauchen
Vielleicht können Sie sich an den 2023 immer wieder in den Medien thematisierten Namen «Play» erinnern. Es handelt sich dabei um eine kriminelle Gruppe, die zahlreiche sogenannte Ransomware-Angriffe auf Schweizer Unternehmen verübt hat. Bei einer solchen Attacke beschaffen sich Cyberkriminelle Zugang zu sensiblen Daten, verschlüsseln diese und fordern in der Folge Lösegeld für die Entschlüsselung. Oft drohen sie zudem mit der Publikation der Daten, sollte das Lösegeld nicht gezahlt werden.
Zu den Opfern von «Play» gehörten unter anderem der Behörden-Software-Anbieter Xplain und die Berner IT-Dienstleiterin Unico Data AG. Bei beiden Angriffen wurden Daten von Kunden der Unternehmen entwendet und teilweise gar im Darknet publiziert – darunter Daten des Bundesamts für Polizei (Fedpol), der SBB, des Kantons Aargau, der Kinokette Pathé sowie der Siloah-Gruppe, einer Versorgerin in der Altersmedizin in der Region Bern. Im selben Halbjahr angegriffen wurden die Medienunternehmen NZZ und CH Media, was im Juni 2023 auch zum Diebstahl von Adressdaten von FMH-Mitgliedern führte.
Denial of Service: Böswillige Überlastung von Websites
Ein anderes Ziel verfolgen sogenannte Denial-of-Service- Attacken, kurz DDoS. Dabei versuchen Hacker, Server durch künstlich erhöhte Nachfragen zu überlasten. Die attackierten Websites sind dann nicht mehr oder nur eingeschränkt erreichbar. Ein Beispiel hierfür war der Angriff auf die Website der eidgenössischen Räte www.parlament.ch im Juni 2023, welcher dazu führte, dass diese zeitweise nicht mehr erreichbar war.
Schützen Sie Ihre Praxis
Je besser Sie die IT-Infrastruktur Ihrer Praxis oder Institution schützen, desto schwerer machen Sie es Cyberkriminellen – und desto geringer ist das Risiko, dass diese mit ihren Machenschaften bei Ihnen Schaden anrichten. Nachfolgend geben wir Tipps, die Sie selbst oder gemeinsam mit Ihrem IT-Partner umsetzen können.
Halten Sie Ihre Infrastruktur aktuell
Veraltete Betriebssysteme und Programme sind ein beliebtes Einfallstor für Cyberkriminelle, denn Updates und Aktualisierungen schliessen häufig bekannte Sicherheitslücken. Um Ihre Praxis oder Institution bestmöglich zu schützen, gilt es deshalb sicherzustellen, dass Ihre IT-Infrastruktur auf dem neuesten Stand ist – und zwar jedes einzelne Arbeitsgerät.
-
Halten Sie Ihr System auf dem neuesten Stand. Dazu zählen die Betriebssysteme der Arbeitsgeräte ebenso wie Browser, E-Mail-Programme, Virenschutzprogramme und andere genutzte Programme auf den Geräten.
-
Installieren Sie Updates umgehend, insbesondere wenn es sich um Sicherheits-Updates handelt.
-
Erstellen Sie regelmässig Backups von Ihren Systemen.
Schützen Sie jedes Arbeitsgerät
Schon ein einziger Computer oder Laptop oder ein einziges Smartphone ohne genügenden Schutz bietet Cyberkriminellen eine Möglichkeit, Ihre Institution anzugreifen. Es kann helfen, ein Inventar aller genutzter Arbeitsgeräte zu erstellen, um den Überblick über die darauf getroffenen Schutzmassnahmen zu behalten.
-
Installieren Sie auf jedem Arbeitsgerät in Ihrer Institution einen aktuellen Virenschutz und aktivieren Sie die Sicherheitsfunktionen Ihres Betriebssystems. Dies gilt für Windows- ebenso wie für Mac-Geräte.
-
Schützen Sie alle Geräte (Computer, Laptop, Router, Handy etc.) durch sichere Passwörter. Acht bis zehn Stellen inklusive Zahlen und Sonderzeichen sind das Minimum.
-
Setzen Sie limitierende Benutzerberechtigungen und arbeiten Sie nicht mit dem Administrator-Account.
Jederzeit aufmerksam sein
Die beste technische Infrastruktur ist nicht sicher genug, wenn ihre Nutzer sich nicht korrekt verhalten. Denn ein einziger falscher Klick kann im schlimmsten Fall grossen Schaden anrichten. Deshalb ist es wichtig, sich im Arbeitsalltag der Relevanz der IT-Sicherheit jederzeit bewusst zu sein. Das gilt für jeden einzelnen Mitarbei- tenden, von der MPA bis zum Chefarzt.
-
Seien Sie vorsichtig bei verdächtigen E-Mails, selbst wenn diese von Ihnen bekannten Absendern zu stammen scheinen. Leider können Absenderadressen einfach gefälscht werden.
-
Löschen Sie verdächtige Nachrichten umgehend, ohne angefügte Dateien im Anhang zu öffnen. Löschen Sie die Nachricht auch im Papierkorb Ihrer E-Mail-Ablage.
-
Klicken Sie nie auf Links in verdächtigen E-Mails und öffnen Sie keine von deren Anhängen.
-
Setzen Sie sichere Passwörter für Ihre Benutzer- accounts
-
Vorsicht beim Surfen! Laden Sie keine unbekannten Programme herunter. Achten Sie bei der Angabe von Informationen auf eine genügende Verschlüsselung. Diese erkennen Sie an dem Schloss-Symbol oben links bei der Anzeige der URL einer Website.
-
Übermitteln Sie sensible Daten nur verschlüsselt an sicher identifizierte Empfänger.
Eine Cyberattacke kann grossen Schaden anrichten: ein mehrere Stunden oder gar Tage andauernder Unterbruch des normalen Praxisbetriebs, Kosten für die Wiederherstellung der Daten, viel Aufwand und nervliche Belastung Ihrerseits, ganz zu schweigen von dem Vertrauensverlust bei Patientinnen und Patienten, wenn diese darum bangen müssen, ob ihre Gesundheitsdaten im Darknet publiziert werden könnten. Ja, eine sorgfältig gepflegte IT-Infrastruktur, eine funktionierende Backup-Lösung und wenn möglich gar eine Schulung aller Mitarbeitenden erfordern einiges an Planung und Aufwand. Doch sie können auch viel bewirken und Ihnen viele Probleme ersparen!
Zur Person
Daniel Huser, Bereichsleiter Projektmanagement & IT-Architektur
Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung
Health Info Net AG
Seidenstrasse 4
8304 Wallisellen
Telefon 0848 830 740
daniel.huser@hin.ch
www.hin.ch
Exklusive Vorteile dank Rahmenverträge
Die Schweiz zählt zu den Ländern mit den durchschnittlich höchsten Ausgaben pro Kopf für Versicherungen weltweit. Damit Sie für die einzelnen Deckungen nicht mehr als nötig bezahlen müssen, haben wir verschiedene vorteilhafte Rahmenverträge ausgehandelt. Sie profitieren so sowohl von einem massgeschneiderten Deckungskonzept wie auch von exklusiven Prämienrabatten.
Wie funktionieren Rahmenverträge?
Dank über 9'000 Kundinnen und Kunden aus dem Ärztesegment können wir die individuellen Bedürfnisse bündeln und mit den einzelnen Anbietern geeignete Lösungen aushandeln. In einem Rahmenvertrag definieren wir die versicherten Deckungen sowie die entsprechenden Bedingungen. Dadurch ist es möglich, gegenüber Standardlösungen individuelle ärztespezifische Vereinbarungen zu treffen. Im Sinne einer Einkaufsgenossenschaft wird ein spezieller Preis festgelegt, wodurch unsere Kundinnen und Kunden zu exklusiven Konditionen gelangen. Häufig ist es dadurch so, dass eine Versicherung bei uns weniger kostet als direkt beim entsprechenden Versicherer.
Welche Rahmenverträge werden angeboten?
Rahmenverträge führen wir in fast allen Versicherungssparten, teilweise mit mehreren Anbietern. Aktuell verfügen wir über folgende Rahmenverträge:
- Berufshaftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Cyberversicherung
- Praxis-Sachversicherung
- Krankentaggeldversicherung
- Unfallversicherung UVG
- Unfall-Zusatzversicherung UVGZ
- Einzelunfallversicherung
- Hausratversicherung
- Privathaftpflichtversicherung
- Gebäudeversicherung
- Krankenversicherung
Wie sieht es in den anderen Bereichen aus?
In der beruflichen Vorsorge (BVG) sind Rahmenverträge nicht nötig, da es bereits spezialisierte Pensionskassen für Ärztinnen und Ärzte gibt. Wir arbeiten hier sehr eng mit vier Ärztestiftungen zusammen. Da diese den sogenannten Verbandsstatus aufweisen, können sich auch selbständige Ärztinnen und Ärzte einfach und individuell versichern. Bei diesen Pensionskassen erhalten unsere Kundinnen und Kunden massgeschneiderte Lösungen, welche sowohl eine attraktive Verzinsung wie auch tiefe Risiko- und Verwaltungskosten aufweisen.
Im Bereich der privaten Vorsorge arbeiten wir mit allen Lebensversicherern der Schweiz zusammen und unterhalten eine eigene Vergleichsplattform, welche auch von anderen Brokern und Beratern genutzt wird. So können wir jederzeit je nach Kundenbedürfnis die am besten geeignete Lösung offerieren und unseren Kundinnen und Kunden einen best-in-class Ansatz anbieten.
Wie kann ich von Rahmenverträgen profitieren?
Senden Sie uns eine Kopie Ihrer bisherigen Versicherungspolice per Mail an mail@fmhinsurance.ch. Gerne prüfen wir für Sie, wann Sie in die Rahmenvertragslösung wechseln können und erstellen Ihnen kostenlos und unverbindlich eine persönliche Offerte. Oder rufen Sie uns unter 031 959 50 00 an, damit unsere Fachspezialisten Sie persönlich beraten können.
Praxisübernahme / Praxisübergabe
Bei der Übernahme bzw. Übergabe einer Praxis gibt es eine ganze Reihe von Themen, die frühzeitig analysiert werden müssen. Es lohnt sich also, die richtigen Überlegungen anzustellen und mit Spezialistinnen/Spezialisten zusammenzuarbeiten. In diesem Artikel können wir diese Themen, die je nach gewähltem Ansatz eine tiefgründigere Analyse erfordern, nur kurz vorstellen. Die folgenden Punkte sind insbesondere für Praxen, die als Einzelfirma geführt werden, relevant. Für eine juristische Person (AG, usw.) kommen weitere Aspekte hinzu. Wir werden hier nicht ins Detail gehen, da knapp 85 Prozent der Praxen als Einzelfirmen geführt werden. Eine externe Beratung ist unerlässlich.
Praxisübergabevertrag – Allgemeines
Die Übergabe einer Praxis erfolgt mit einem schriftlichen Vertrag, in welchem die Adresse der Praxis, die Gegenstand des Verkaufs ist, das Übergabedatum und die Namen der involvierten Parteien aufgeführt sind. Es ist wichtig, die Vertragsparteien genau zu bezeichnen.
Wir empfehlen Ihnen ein Inventar der zu übernehmenden Praxiseinrichtung und des Materials zu erstellen und festzulegen, wer die Kosten für die Entsorgung von nicht übernommenen Objekten übernimmt. Diese Listen bilden einen Anhang zum Vertrag und sind dazu gedacht, böse Überraschungen am Tag der Übernahme zu vermeiden.
Zudem ist es wichtig verschiedene Szenarien im Vertrag vorzusehen. Es kann beispielsweise sein, dass zwischen der Unterzeichnung des Vertrages und der Übergabe der Praxis gewisse Objekte (Möbel, Geräte) repariert oder ersetzt werden müssen oder dass eine der Vertragsparteien arbeitsunfähig wird oder stirbt. Es muss also bestimmt werden, wer die Kosten in einem solchen Fall zu tragen hat.
Weitere wichtige Punkte des Praxisübergabevertrages sind:
Patientendossier
Das Patientendossier ist nicht nur ein Werkzeug für die Ärztin / den Arzt, es dient auch als Beweismittel im Streitfall. Die Käuferin oder der Käufer muss sich verpflichten, die Dokumente während 20 Jahren nach der letzten Behandlung aufzubewahren. In jedem Fall darf die Käuferin oder der Käufer die Krankengeschichten nur mit dem Einverständnis der Patienten einsehen.
Übernahmepreis und Zahlungsmodalitäten
Ein wesentlicher Bestandteil des Vertrages ist der zu bezahlender Preis und die Zahlungsmodalitäten. Er wird im Rahmen der Verhandlungen zwischen Verkäuferin/Verkäufer und Käuferin/Käufer festgelegt. Eine Praxisbewertung bildet eine nützliche Grundlage für die Verhandlungen.
Die Zahlungsmodalitäten können unterschiedlich sein. Entweder bezahlt die Käuferin oder der Käufer den Gesamtpreis bei der Praxisübernahme oder er leistet mehrere Ratenzahlungen. In der Regel erfolgt die erste Zahlung bei Vertragsunterzeichnung und die zweite bei der Übernahme. Manchmal erfolgt die zweite Zahlung in zwei Raten. Wir empfehlen Ihnen die Ratenzahlungen nicht über einen zu langen Zeitraum zu erstrecken. Sorgen Sie für eine steuerliche Optimierung des Verkaufs / Kaufs der Praxis mit Unterstützung Ihrer Treuhänderin oder Ihres Treuhänders.
Wert
Um den Preis der Praxis festlegen zu können, müssen Sie deren Wert kennen. Wir werden häufig für Praxisbewertungen angefragt (Einzelfirma oder AG/GmbH). Eine solche beinhaltet die folgenden zwei Elemente: den materiellen Wert (Inventar) und den immateriellen Wert (Goodwill). Der Goodwill, der weder unmoralisch noch illegal ist, bietet der Nachfolgerin oder dem Nachfolger die Gelegenheit, eine bereits funktionierende Firma zu übernehmen und damit ohne Zeitverlust weiterzuarbeiten. Der Goodwill kann als Aufpreis und «Anerkennung» für eine gut etablierte und geführte Praxis betrachtet werden. Es gibt zahlreiche Berechnungsmodelle. Der von FMH Services (Consulting) berechnete immaterielle Wert basiert auf einem Prozentsatz des durchschnittlichen Umsatzes der letzten drei bis fünf Jahre, der aufgrund der Praxisbesonderheiten, wie beispielsweise das Personal, der Standort, die Betriebskosten der Praxis, usw., gewichtet wird. Der materielle Wert wird mittels Abschreibung der Sachanlagen berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass diese nutzbar sind und in der Praxis verbleiben. Um eine AG/GmbH zu bewerten, müssen weitere Positionen berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die stillen Reserven und weitere Bilanzposten.
Personal
Bei der Übernahme einer Praxis übernimmt die Käuferin oder der Käufer automatisch die mit dem Personal bestehenden Vertragsverhältnisse (Arbeitsvertrag, 2. Säule, usw.), es sei denn, das Personal lehnt diese ab (Art. 333 OR) nachdem es von der Verkäuferin oder vom Verkäufer rechtzeitig über die Übernahme informiert wurde. Eine Kündigung der Verträge durch die Verkäuferin oder den Verkäufer und die anschliessende Wiedereinstellung desselben Personals durch die Käuferin oder den Käufer ist nicht erlaubt.
Nun kommen wir zu verschiedenen Punkten, die insbesondere die Ärztinnen und Ärzte betreffen, die eine Praxis eröffnen wollen. Darin sind aber auch einige Punkte aufgeführt, die für Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis übergeben wollen, interessant sein können.
Rechtsformen
Eine Arztpraxis kann als Einzelfirma, als juristische Person (AG/GmbH) oder als einfache Gesellschaft betrieben werden. Viele Ärztinnen und Ärzte wollen eine AG/GmbH gründen, häufig ohne dabei über die konkreten Folgen nachzudenken. Bevor man eine Rechtsform wählt, ist es wichtig, seine persönliche Situation zu analysieren. Es müssen verschiedene Themen wie die Steuern (Doppelbesteuerung), die Vorsorge, die Gründungskosten, die gewünschte Flexibilität, die Anzahl der in der Praxis tätigen Ärztinnen und Ärzte, usw. berücksichtigt werden. Die Ärztin oder der Arzt, die/der sich für eine AG/GmbH entscheidet, wird damit zum Angestellten der von ihr/ihm gegründeten Struktur. Dies bedeutet, dass die Zulassung zur Abrechnung und die ZSR-Nummer auf die Firma lautet.
Versicherungen
Den Ärztinnen und Ärzten in der Privatpraxis empfehlen wir Versicherungen zur Abdeckung von bestimmten Risiken abzuschliessen. Dazu gehören die Lohnausfallversicherung, die Sachversicherung, die Berufshaftpflichtversicherung, die Diebstahl- und Elementarversicherung oder auch die Cyberversicherung und die Rechtsschutzversicherung. Letztere kann insbesondere im Falle von Streitigkeiten im Bereich Arbeitsrecht, Mietrecht, usw. von Nutzen sein. Es ist auch wichtig, sämtliche Versicherungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (AHV/IV/EO, ALV, BU, NBU, BVG) abzuschliessen, ohne dabei die eigene Vorsorge zu vergessen. Zudem sollten die Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis übergeben sicherstellen, dass ihre Berufshaftpflichtversicherung mögliche Streitfälle, während 20 Jahren nach der Berufsaufgabe deckt.
Business Plan
Der Business Plan beinhaltet die wichtigsten Eckdaten zur Praxis und deren Funktionsweise. Es handelt sich um eine Machbarkeitbeurteilung des Projektes. Im Text sind die wesentlichen Punkte der Vision und der Rahmenbedingungen der zukünftigen Praxis zusammengefasst: die Betreiber, das Personal, den Praxisstandort, das Marketing, die interne Organisation, die Strategie, die Rechtsform und eine Analyse der Chancen und Risiken der Praxis. Der finanzielle Teil zeigt die finanzielle Entwicklung der Praxis, d.h. die potenziellen Einnahmen, die Kosten, die Investitionen und die Finanzierung auf. Die Qualität des Dossiers wird sich im Falle von Kreditanträgen auf die Bonität auswirken. Beginnen Sie also rechtzeitig mit Ihren Überlegungen und Vorbereitungen, bevor Sie den Schritt in die Selbständigkeit wagen (wenn möglich ein Jahr vorher) und holen Sie sich dafür die nötige Unterstützung.
Fazit
Die Übergabe bzw. Übernahme oder die Gründung einer Praxis sind langfristige Projekte, die zahlreiche Themen betreffen, die besprochen und analysiert werden müssen. Dies erfordert häufig mehr Zeit als man denkt. Wichtig ist in jedem Fall, die entsprechende Unterstützung durch Spezialistinnen und Spezialisten in Anspruch zu nehmen, um sämtliche Aspekte zu berücksichtigen und Fehler zu vermeiden.
Olivier Dousse
Consultant
Überschuldung – Achtung bei der Übernahme einer Arztpraxis AG/GmbH
In der Schweiz stehen sehr viele Arztpraxen kurz davor, altershalber ihre Nachfolge regeln zu müssen. Ein Verkauf wäre der Idealfall. In der Realität gestaltet sich das meistens sehr schwierig und anspruchsvoll. Interessenten/-innen, die eine Praxis übernehmen wollen, sind rar. Die zu verkaufenden Arztpraxen werden entweder in der Rechtsform einer Einzelunternehmung oder einer AG/GmbH geführt.
Herr Brenner, worauf muss ich achten, wenn ich eine Arztpraxis kaufen will, die in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft geführt wird?
Zuerst geht es um Informationsbeschaffung. Ich benötige Unterlagen wie die letzten drei Jahresabschlüsse, detaillierte Umsatzstatistiken, Auswertungen eines Trustcenters, Revisionsberichte und wenn möglich eine aktuelle Praxisbewertung. Allenfalls ist eine Due Diligence (Überprüfung) empfehlenswert. Ebenso wäre eine Kopie des aktuellen Mietvertrags mit Grundriss sinnvoll.
Woraus sehe ich, dass eine Arztpraxis in der Rechtsform einer AG gesund und nicht überschuldet ist?
Wichtig sind Liquidität, das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital und die Rentabilität der Praxis. Eine aktuelle Bilanz zeigt, ob das Fremdkapital (die Schulden) höher ist als die Aktiven. Dann besteht rein formell eine Überschuldung. Im Detail lohnt sich hier die Überprüfung durch einen auf Arztpraxen spezialisierten Treuhänder. Natürlich gibt es auch sehr viele Informationen und Faktoren einer Praxis, die auf finanzielle und administrative Probleme hindeuten können. Meistens sind die Grundübel mangelnde Führung der Praxis, mangelhafte und nicht nachgeführte Buchhaltung und chaotische Administration. Im Umfeld der Praxis ist z. B. zu hören, dass eine hohe Fluktuationsrate beim Personal besteht. Rechnungen würden nicht pünktlich bezahlt, oder es liefen sogar Betreibungen. Wie erfahre ich das? Im Umkreis einer Arztpraxis wird dies sehr schnell bekannt. Früher oder später erfahren das die meisten Berater, die in diesem Bereich tätig sind.
Wie gehe ich als Käufer/in bei der Übernahme einer Arztpraxis AG konkret vor?
Neben den zu beschaffenden Unterlagen und Informationen benötigt der/die Käufer/in ein Budget mit Investitionsplan, Planerfolgsrechnung und Liquiditätsplan. Daraus geht hervor, ob die Praxisübernahme lohnenswert ist. Entscheidend ist nicht, wie viel Umsatz der Vorgänger mit der Praxis erzielt hat, sondern wie viel Umsatz mit entsprechenden Konsultationen ich als Käufer/in erzielen kann.
Was ist ein Share Deal?
Bei einem Share Deal werden die Aktien einer Praxis AG verkauft. In der Arztpraxis AG befinden sich Positionen wie z. B. Bankkonto, Patientenguthaben per Stichtag, Medikamentenlager, Apparate und Instrumente sowie als Fremdkapital noch unbezahlte Kosten (Verbindlichkeiten). Die Praxis geht als Ganzes an die Käuferin über. Alle bestehenden Verträge zwischen der AG und Dritten, wie Arbeitsverträge, Mietvertrag, Leasingverträge, bleiben weiterhin bestehen. Eher selten ist ein Asset Deal, das heisst der Verkauf einzelner Aktiven.
Kann ich als Käufer/in für die Finanzierung des Aktienkaufs mein bisher angespartes BVG-Guthaben beziehen?
Wenn ich Aktien einer Arztpraxis kaufe und dadurch meistens Alleineigentümer/in werde, so trete ich mit meiner eigenen AG in ein Anstellungsverhältnis. Ich bin dadurch sozialversicherungsrechtlich unselbstständig erwerbend. Das aktuelle BVG-Guthaben kann ich dadurch nicht beziehen. Sonst müsste ich die Praxis in der Rechtsform als Einzelunternehmung betreiben, was einen Statuswechsel von bisher unselbstständig erwerbend auf neu selbständig erwerbend bedeuten würde.
Was sind die Steuerfolgen bei einem Share Deal?
Falls die Verkäufer der Aktien der Arztpraxis AG einen Gewinn erzielen, so ist dieser beim Verkäufer steuerfrei. Es handelt sich grundsätzlich um einen einkommenssteuerfreien Kapitalgewinn, falls sich die Aktien bisher im Privatvermögen des Verkäufers befunden haben. Trotzdem bestehen steuerliche Risiken, die eine sorgfältige Planung und Umsetzung erfordern.
Zur Person
Martin Brenner
Dipl. Steuerexperte, Treuhänder mit eidg. FA und Finanzplaner mit eidg. FA
Brenner Treuhand AG*
Gewerbestrasse 6
9242 Oberuzwil
Telefon 071 955 05 65
mail[at]fmhtreuhand.ch
www.fmhtreuhand.ch
*Brenner Treuhand AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Haben Sie bereits eine Cyberversicherung?
Meldungen über Hackerangriffe oder Datenklau liest man fast täglich in den Medien. Das Bewusstsein zu Cyberrisiken wächst daher laufend und auch die Nachfrage nach Cyberversicherungen steigt kontinuierlich. Aber was umfasst diese Versicherung genau? Wir haben für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zu unserer Speziallösung zusammengestellt.
Was versichert eine Cyberversicherung?
Grundsätzlich sind die elektronischen Daten des versicherten Unternehmens gedeckt. Unsere ärztespezifische Lösung gliedert die Deckung in folgende zwei Hauptbestandteile: Eigenschäden und Haftpflichtschäden. Zusätzlich umfasst unser Rahmenvertrag auch eine Leistung für Krisenmanagement sowie weiteren Deckungsbausteinen.
Was versteht man unter Eigenschäden?
Unter Eigenschäden ist die Wiederherstellung der elektronischen Daten versichert, die infolge eines Cyber-Ereignisses abhandengekommen sind oder zum Beispiel durch eine Verschlüsselung nicht mehr zugänglich sind. Weiter deckt die Versicherung auch den aus der Betriebsunterbrechung resultierenden Ertragsausfall sowie die entstandenen Mehrkosten.
Was deckt die Cyber-Haftpflichtversicherung?
Die Haftpflichtversicherung deckt Schadenansprüche Dritter infolge eines Cyber-Ereignisses. Darunter fallen beispielsweise die Zerstörung, Beschädigung, Veränderung, Nichtverfügbarkeit oder Verlust der Daten eines Patienten, welche bei einer Praxis gespeichert wurden. Auch Datenschutzverletzungen infolge eines Cyberereignisses sind versichert, was insbesondere seit dem Inkrafttreten des verschärften Datenschutzgesetztes seit 01.09.2023 sehr wichtig ist.
Welche Kosten sind bei einer Datenschutzverletzung versichert?
Zu den versicherten Kosten zählen die juristische Beratung durch einen externen spezialisierten Rechtsanwalt, die Identifizierung der betroffenen Personen sowie deren Benachrichtigung, die Kommunikation mit den zuständigen Behörden, die Einrichtung einer telefonischen Hotline sowie Anwaltshonorare oder Gerichtskosten in einem Strafverfahren.
Welche Geräte sind versichert?
Versichert sind einerseits Daten, die auf Geräten gespeichert sind, welche zum IT-System des versicherten Betriebes gehören. Dazu zählen Server, PCs, Laptops oder Tablets. Weiter sind auch Daten versichert, die sich auf externen Cloud-Computing Systemen befinden wie beispielsweise ein Cloud-Speicherdienst.
Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer?
Wie bei anderen Versicherungen muss im Schadenfall der Versicherer umgehend informiert und versucht werden, den Schaden möglichst zu minimieren. In der Cyberversicherung muss zusätzlich ein regelmässiges Backup der Daten erfolgen und dieses Backup vom Netzwerk getrennt aufbewahrt werden. Weiter müssen aktuelle Schutzsysteme wie Virenscanner oder Firewall eingesetzt werden und die empfohlenen Sicherheitsupdates auf eingesetzten Betriebssystemen und Software installiert werden.
Welche Hilfe erhält ein Kunde im Schadenfall?
Nebst der Versicherungsdeckung haben wir bei der Auswahl unseres Rahmenvertragspartners grossen Wert auf rasche, zuverlässige und unkomplizierte Hilfe im Schadenfall gelegt. Unser Versicherer betreibt mit einem externen Spezialisten eine 24-Stunden Hotline. Im Schadenfall oder auch schon im Verdachtsfall hilft Ihnen somit ein Fachspezialist und leitet rasch Massnahmen ein, um den möglichen Schaden zu minimieren und zu beheben.
Gibt es auch Dienstleistungen bezüglich Prävention?
Unser Rahmenvertragspartner bietet mit der Cyberversicherung einen kostenlosen Präventionsservice. Kundinnen und Kunden erhalten einerseits technische Ratschläge zur Erhöhung ihrer Sicherheit. Andererseits umfasst die Dienstleistung eine Schulungsplattform, auf welcher sich alle Mitarbeitenden eines versicherten Unternehmens bezüglich Cyber-Sicherheit weiterbilden können.
Wieviel kostet eine Cyberversicherung?
Die Prämie ist abhängig vom gewählten Versicherungsumfang und von der Grösse der zu versichernden Praxis. So sind bei unserer Lösung die Anzahl der Praxismitarbeitenden sowie der Praxisumsatz massgebend. Eine Versicherungsdeckung in unserem Rahmenvertrag ist ab CHF 485 erhältlich. Gerne erstellen wir bei Interesse kostenlos und unverbindlich eine persönliche Offerte.
Wie kann ich eine Offerte bestellen?
Am einfachsten füllen Sie unser Webformular unter www.fmhinsurance.ch/cyber aus oder Sie rufen uns an unter 031 959 50 00, um sich persönlich beraten zu lassen.
Die Voraussetzungen der OKP-Zulassung und die Höchstzahlen
Wer als Ärztin/Arzt fachlich eigenverantwortlich tätig sein möchte, benötigt eine entsprechende Berufsausübungsbewilligung des Tätigkeitskantons. Seit dem 1. Januar 2022 liegt es zusätzlich in der Kompetenz der Kantone, die Zulassung für die Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zu überprüfen und zu erteilen. Des Weiteren kann eine weitere Hürde für die fachlich eigenverantwortliche Tätigkeit hinzukommen: die «Höchstzahlen». Zu beachten ist: Die nachfolgenden Ausführungen betreffen den Stand in Sachen Zulassungssteuerung per Dezember 2023.
Frau Geisseler, wie sehen für Sie als Spezialistin für Bewilligungen derzeit die Herausforderungen bezüglich der Höchstzahlen aus?
Aufgrund der schwierigen Umsetzung auf Verordnungsstufe sowie der Eruierung der Faktoren, welche in Bezug auf die Höchstzahlen zu berücksichtigen sind, haben wenige deutschsprachige Kantone bis anhin Höchstzahlen festgelegt. Die Definition der Faktoren zur Festlegung der Höchstzahlen stellt eine Herausforderung dar, weil vorab das Angebot an Ärztinnen und Ärzten im ambulanten Bereich (Spital, spitalambulante und ambulante Praxis), die Herleitung je eines Versorgungsgrades nach Region und Fachgebiet wie auch ein Gewichtungsfaktor festzulegen ist. Daraus ergibt sich die entsprechende Höchstzahl oder auch Vollzeitäquivalenz (VÄZ). Beispielsweise kann es eine Herausforderung sein, wie in Bezug auf die VÄZ eine Ärztin betrachtet wird, welche sich derzeit im Mutterschaftsurlaub befindet und danach ihr Pensum verändern möchte.
Gibt es bereits kantonale Erfahrungen in Bezug auf die Höchstzahlen?
Beispielsweise haben die beiden Kantone Basel-Land und Basel-Stadt per 1. April 2022 eine Vollzugsverordnung erlassen, in welcher die Höchstzahlen für Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Bereich aufgrund der Arbeitszeit in Vollzeitäquivalenten festgelegt sind. Diese Verordnung wurde jedoch in Basel-Land am 18. Januar 2023 nach einem Gerichtsprozess wieder aufgehoben, da das übliche Gesetzgebungsverfahren nicht eingehalten wurde. Für den Kanton Basel-Stadt gilt die Vollzugsverordnung nach wie vor.
In Basel-Stadt darf nun gemäss § 4 Abs. 1 dieser Verordnung beispielsweise eine OKP-Zulassung übertragen werden, wenn die Übernahme im selben Fachgebiet und in derselben Gemeinde stattfindet sowie der Antrag zur Übernahme innerhalb von drei Monaten seit Aufgabe der Praxistätigkeit des Vorgängers / der Vorgängerin bei der Gesundheitsdirektion eingeht. Dies ist aber nicht zwingend in jedem Kanton der Fall; so verneint der Kanton Zug derzeit eine Praxisübergabe in den Fachgebieten mit Höchstzahlen.
Ein anderes Beispiel kommt aus Genf: Dort wurden Wartelisten eingeführt. Deren Problematik ist es, dass das Mitspracherecht der Praxisinhaber und Praxisinhaberinnen eingeschränkt ist, da grundsätzlich immer die Person auf der Position eins der Warteliste als nächster Kandidat oder nächste Kandidatin die Praxis übernehmen darf.
Was muss ich also beachten, wenn ich eine Praxis gründen oder übernehmen will?
Die gesamte Bewilligungsthematik spielt eine enorm wichtige Rolle bei der Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit im ambulanten Bereich und auch im Rahmen der Praxisübergabe. Je nach Handhabung der Höchstzahlen kann eine fliessende Übergabe einer Arztpraxis erschwert werden. Die Verkäuferschaft unterliegt der Besitzstandsgarantie in Bezug auf die OKP-Zulassung, so dass je nach Kanton zugunsten der Käuferschaft darauf verzichtet werden müsste. Dies sollte so auch in einen Praxisübernahmevertrag einfliessen. Bei der Praxiseröffnung gilt es das Thema der Bewilligung und der Höchstzahlen frühzeitig anzugehen. Gerade auf die Höchstzahlen ist ein enormes Augenmerk zu legen, wobei stets auch die übrigen Zulassungsvoraussetzungen gemäss den kantonalen Vorgaben wie auch dem Krankenversicherungsgesetz und Krankenversicherungsverordnung zu beachten sind.
Jessica Geisseler
Consultant
Master of Law
Kennzahlen einer Pensionskasse
Deckungsgrad, Umwandlungssatz und Verzinsung – das sind wohl die bekanntesten Kennzahlen einer Pensionskasse. Natürlich sind diese Werte wichtig, jedoch sagen sie isoliert betrachtet nicht viel aus. Daher muss eine fundierte Analyse einer Pensionskasse breiter abgestützt sein.
Deckungsgrad
Der Deckungsgrad gibt an, wie hoch die Leistungsversprechen einer Pensionskasse mit Vermögenswerten abgedeckt sind. Ein Deckungsgrad von 110 % beschreibt somit, dass die Kasse stabil ist und mehr als 100 % der künftigen Verpflichtungen gedeckt sind. Wie werden aber die künftigen Verpflichtungen berechnet? Dazu ein kleines Beispiel: wird eine in 10 Jahren zu leistende Rentenzahlung von CHF 100 mit 1.5 % abdiskontiert, dann müssen heute CHF 86.15 sichergestellt werden. Wendet eine Pensionskasse jedoch einen technischen Zins von 2.5 % an, dann müssen nur CHF 78.10 bereitgestellt werden. Zwei Pensionskassen mit gleichem Deckungsgrad können somit trotzdem unterschiedlich solvent sein.
Weitere wichtige Qualitätskriterien, welche den Deckungsgrad beeinflussen, sind z. B. die kalkulatorische Sterbetafel. Hier gibt es die Generationentafel und die Periodentafel. Bei der Generationentafel wird die steigende Lebenserwartung miteinbezogen und somit leben in dieser Darstellung die Menschen länger als in der Periodentafel. Auch dazu ein kleines Beispiel. Wendet eine Pensionskasse einen technischen Zins von 1.5 % an und muss eine jährliche Rente von CHF 100 für 22 Jahre garantieren, dann muss diese Kasse ein Kapital von CHF 1'890 sicherstellen. Sind es hingegen kalkulatorisch 24 Jahre, dann sind bereits CHF 2'033 nötig.
Der dritte wichtige Faktor ist das Verhältnis aktiv Versicherter zu Altersrentnern. Dies ist deshalb so wichtig, weil die Rentner in den Genuss einer faktisch garantierten Rente kommen. Sprich, wenn eine BVG-Stiftung den technischen Zinssatz reduziert, dann muss sie den aktuellen Rentnern den durch die Senkung entgangenen künftigen Zins ausfinanzieren, ansonsten würden die künftigen Renten sinken. Da die Stiftung über kein eigenes Vermögen verfügt, wird sie sich also in irgendeiner Form bei den aktiven Versicherten bedienen müssen. Dies nennt man Verrentungsverluste oder auch einfach Umverteilung. Daher waren in der Vergangenheit Versicherte in Kassen mit hohem Rentneranteil stärker von der Umverteilung betroffen und wurden überproportional zur Kasse gebeten.
Umwandlungssatz
Der Umwandlungssatz verrät, wie hoch das vorhandene Vorsorgeguthaben im Pensionierungszeitpunkt verrentet wird. Ein Umwandlungssatz von 5.5 % ergibt bei einem Vermögen von CHF 100'000 eine jährliche Rente von CHF 5'500.
Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Umwandlungssatz-Modelle: der gesplittete oder der umhüllende Umwandlungssatz. Beim gesplitteten Modell muss das obligatorische Guthaben gemäss Gesetz mit 6.8 % verrentet werden. Da dieser Satz mathematisch gesehen zu hoch ist, wird der überobligatorische Teil meistens sehr tief verrentet (z. B. 4 %), so dass die Stiftung eine Ausgleichsmöglichkeit hat.
Beim umhüllenden Modell wird dagegen das gesamte Kapital mit dem gleichen Umwandlungssatz verrentet (z. B. 5 %). Damit dem Gesetz genüge getan wird, gibt es eine Schattenrechnung mit den obligatorischen Mindestleistungen. Der höhere Wert kommt zur Anwendung. Für die Versicherten mit Einkommen nahe der BVG-Mindestleistungen ist tendenziell das gesplittete und für Versicherte mit höherem Einkommen das umhüllende Modell besser.
Ob ein hoher Umwandlungssatz von Vorteil ist, kommt ganz auf die individuelle Ausgangslage jeder einzelnen versicherten Person an. Für eine ältere Person mit Rentenwunsch ist ein hoher Umwandlungssatz sicher zentral. Umso weiter in der Ferne der Pensionszeitpunkt liegt, desto attraktiver ist jedoch ein tiefer Umwandlungssatz, da die Auswirkung der unerwünschten Umverteilung sehr viel geringer ist.
Verzinsung
Die in der Vergangenheit gewährte Verzinsung ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Es handelt sich hier jedoch um eine Vergangenheitsbetrachtung, welche nicht Gewähr bietet, dass dies auch so in der Zukunft stattfinden wird. Trotzdem deutet eine hohe Verzinsung tendenziell auf eine gesunde Kasse mit durchschnittlich tieferen Verrentungsverlusten und tendenziell höherem Spielraum bei der Anlagewahl hin. So ist auch eine Analyse der Anlagestrategie sinnvoll, um das künftige Ertragspotential der Stiftung einschätzen zu können. Eine Stiftung, welche über wenig Spielraum verfügt und grösstenteils in Obligationen investiert ist, wird künftig wohl kaum ansprechende Renditen erzielen können.
Kosten
Selbstverständlich sind auch die Kosten eine wichtige Kennzahl. Den grössten Kostenblock stellen die Risikoleistungen dar. So schreibt der Gesetzgeber vor, dass Personen vor Erreichen des Referenzalters mindestens 4 % der gesamten Prämien für Risikodeckungen wie Tod und Invalidität aufwenden müssen. Damit sind sowohl Renten- wie auch Kapitalleistungen gemeint. Die restlichen Kosten sind Verwaltungskosten für die Betreuung der Versicherten und die Vermögensverwaltung.
Fazit
Ein Pensionskassenvergleich aufgrund der Kennzahlen ist nicht einfach und erfordert oftmals ein fundiertes Verständnis zu den Funktionsweisen von Pensionskassen. Zudem sind auch noch viele weitere Faktoren wie z. B. die zur Verfügung stehenden Anlagepläne, die Anlagemöglichkeiten oder ein allfälliger Verbandsstatus wichtig. Je nach individueller Situation können auch reglementarische Punkte wie die passende Begünstigungsmöglichkeit, Rückvergütung von Einkäufen im Todesfall usw. wichtige Entscheidungskriterien sein. Da für viele Ärztinnen und Ärzte das BVG neben dem Eigenheim das grösste Anlagegefäss darstellt, ist eine wohlüberlegte Auswahl der richtigen Stiftung absolut zentral.
Kauf einer Arztpraxis: Welches ist der faire Wert?
Irgendwann kommt für viele Praxisbesitzer/innen die Frage: Was zahlt man im Markt für eine Praxis? Die gleiche Frage stellen sich auch Ärztinnen und Ärzte und weitere Akteure im Gesundheitswesen, welche eine Praxis übernehmen oder sich an einer Praxis finanziell beteiligen möchten. Eine Antwort darauf zu geben, ist nicht einfach, dennoch soll in diesem Artikel das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet werden.
Folgender Fall bringt die Thematik gleich etwas näher: Eine Praxis in der Unternehmensform einer juristischen Person, als AG konstituiert, wurde durch das Treuhandunternehmen des Praxisbesitzers mit CHF 24.5 Mio. bewertet. Die Käuferpartei ist mit einem «Gegengutachten » auf CHF 6.5 Mio. gekommen. Die Unterschiede in der Bewertung sind beachtlich und können grundsätzlich auch begründet werden. Es sind dabei verschiedene Bewertungsgrundsätze und damit auch eine unterschiedliche Zahlenbasis angewendet worden. Einerseits wurde beim viel höheren Wert die sogenannte DCFMethode (DCF = Discounted-Cash-Flow) verwendet. Dabei stellt man – vereinfacht gesagt – Annahmen über die Zukunft auf: zukünftige Geldflüsse bspw. aus Umsätzen oder Investitionen werden auf den gegenwärtigen Zeitpunkt abdiskontiert. Die Summe davon stellt den «heutigen Wert» des Unternehmens dar. Er zeigt auf, mit welchen Geldzuflüssen ein neuer Eigentümer in Zukunft rechnen kann. Auf der anderen Seite kam eine Methode zur Anwendung, welche auf aktuelle Zahlen resp. dem letzten Jahresabschluss basiert. Da stellt sich nun für den aussenstehenden die Frage, wo nun für diese Praxis der «faire» Wert bzw. Preis liegen soll. Die Antwort wird bei jeder Partei anders ausfallen, je nachdem, welche Sichtweise man einnimmt. Obiges Beispiel war auf eine juristische Person bezogen; die gleichen Themen stellen sich aber ebenso bei einer Praxis in Form einer Einzelunternehmung. Die Erfahrungen zeigen, dass gerade von der Käuferseite der Wille, hohe Aufschläge auf die Substanz zu bezahlen, eher gering ist. Das Argumentarium ist, dass man ja gleich nebenan eine Praxis eröffnen könnte und die Patientinnen und Patienten infolge eines Arztmangels die Praxis sowieso aufsuchen würden. Damit stellt sich wiederum die Frage, wie die Parteien auf einen geeigneten Preis gelangen.
Die DCF-Methode scheint nicht geeignet
Wenn man nun aber den Praxismarkt anschaut, dann wird ersichtlich, dass diese Vorgehensweise leider selten zu einem Verkaufsabschluss führt. Die FMH Services erstellt seit mehr als 30 Jahren Praxisbewertungen und kann in dieser Frage auf eine grosse Anzahl Erfahrungswerte zurückgreifen. Auswertungen der letzten Jahre zeigen immer wieder, dass sich die Preise für eine Praxis kaum an einer DCF-Methode anlehnen. Diese Methode scheint den Wert einer Praxis und damit einhergehend auch deren Refinanzierung schlecht wiederzugeben. Bei der DCF-Methode mit der zukunftsgerichteten Datenbasis gibt es immer wieder Diskussionen, wie sich der Tarif, die Taxpunkte oder auch die Kosten und damit der Gewinn resp. der Cash-Flow in Zukunft entwickeln, was schliesslich die Datenbasis der Bewertung darstellt. Zudem muss bei einer Gruppenpraxis natürlich der Ärztemangel ebenfalls berücksichtigt werden: Kann die gekaufte Praxis in Zukunft auch mit weiteren Ärztinnen und Ärzten betrieben werden?
Wenn man die von den bekannten «Bewertungsunternehmen» erstellten Unternehmensbewertungen für Arztpraxen anschaut, so sieht man mittlerweile die DCF-Methode immer weniger. Die anderen gängigen Bewertungsmethoden wären einerseits die Praktiker- andererseits die Ertragswert- und Substanzwert-Methode. Alle gelangen in der einen oder anderen Form zur Anwendung. Was wäre nun aber die Empfehlung aus Sicht eines Branchenkenners? Zu empfehlen ist, was sich, wie in den meisten Fällen im Markt durchsetzt. Bei den Praxisverkäufer/innen wie auch Praxiskäufer/innen wird die Bewertung der FMH Services bevorzugt. Ausserdem zeigt sich, dass die so errechneten Unternehmenswerte durch die Banken finanziert werden. Damit wäre die Empfehlung, auf diese Methode zu setzen: FMH Services hat, wie oben beschrieben, vor über 30 Jahren eine eigene Bewertungsmethode geschaffen, welche seit dieser Zeit mehrmals den Marktbedürfnissen angepasst wurde. Die Methode kann sowohl bei Einzelfirmen als auch bei juristischen Personen angewendet werden. Auch kann sie bei kleinen Praxen wie bei grösseren Unternehmungen verwendet werden.
Wert ist nicht gleich Preis
Ein wichtiger Aspekt bei der Preisverhandlung bleibt aber die Tatsache, dass eine Bewertung nur einen grundsätzlichen Wert für eine Praxis aufzeigt. Der errechnete Praxiswert müsste in einem Markt unter normalen Bedingungen erzielt werden können. Der finale Preis kann sich deshalb von diesem Wert unterscheiden, wenn im Markt, d.h. in der Region der Praxis Angebot und Nachfrage zu stark voneinander abweichen. Wenn also für eine Praxis nur ganz wenige oder sogar nur ein Interessent vorhanden ist, dann kann der Preis auch unterhalb der Bewertung liegen resp. vice versa.
Die Bewertungsmethode der FMH Services
Diese Bewertungsmethode unterscheidet je nach Gesellschaftsform verschiedene Module: Bei der Einzelfirma werden der Inventarresp. materielle Wert sowie der Goodwill resp. immaterielle Wert berechnet. Bei einer juristischen Person, also der Rechtsform AG oder GmbH, muss zusätzlich der Substanzwert der AG auf Basis der Bilanzzahlen berechnet werden.
Die Berechnung des immateriellen Wertes beruht auf einer Basis von 20 % der durchschnittlichen Umsätze der letzten 3-5 Jahre, sofern sich diese nicht stark verändert haben. Auf dieser Basis wird dann ein Aufoder Abschlag berechnet, welcher sich an Faktoren wie Organisation, Kosten, Lage der Praxis, Personal, Patientenkollektiv etc. orientiert. Dabei wird auch ersichtlich, dass der immaterielle Wert nicht nur auf den Patientinnen und Patienten beruht, sondern auf einer bestehenden Praxisstruktur aufbaut.
Der Wert der materiellen Dinge wie Liegen, Ausbaukosten etc. wird mit degressiven Abschreibungssätzen zwischen 10 % bis 20 % kalkuliert, je nach Art des Gegenstandes. Mittels einer degressiven Abschreibungsmethode kann der Fortführungswert eines Gegenstandes am besten reflektiert werden.
Falls es sich wie oben beschrieben um eine Praxis in der Form einer AG handelt, ist noch die Substanz der Unternehmung zu ermitteln und zu den obigen Werten hinzuzufügen. Die Substanz einer AG entspricht vereinfacht gesagt dem in der AG befindlichen Eigenkapital, welches über die letzten Jahre erwirtschaftet wurde und bei einem Verkauf der Aktien mitveräussert wird.
Patrick Tuor
Leiter Beratung / Mitglied der Geschäftsleitung
lic.rer.pol., MAS in Managed Health Care
Steuerprivilegien der persönlichen Vorsorge
Die persönliche Altersvorsorge und Risikoabsicherung sind sehr wichtig. So wichtig, dass der Staat verschiedene Steuerprivilegien zur Förderung vorsieht. Welche Möglichkeiten es gibt, die eigene Steuersituation zu verbessern, wollten wir von Roger Ledermann wissen, Finanzplanungsexperte der Roth Gygax & Partner AG.
Herr Ledermann, Steuern sparen und Altersvorsorge werden oft in einem Zug genannt. Was hat es damit auf sich?
Der Staat ist daran interessiert, dass seine Bürgerinnen und Bürger Verantwortung in der persönlichen Alters- und Risikovorsorge übernehmen. Deshalb gewährt der Staat unter Einhaltung bestimmter Richtlinien attraktive Steuerabzüge für Beiträge an die berufliche Vorsorge (BVG) und die private Vorsorge (Säule 3a).
Sie erwähnen die berufliche Vorsorge. Diese wird durch den Arbeitgeber definiert und die Beiträge durch Lohnabzüge finanziert. Wie kann man hier Einfluss nehmen?
Sie haben Recht was Arbeitnehmende anbelangt. Ab einem jährlichen Einkommen von CHF 22'050.- sind Arbeitnehmende obligatorisch in einer Pensionskasse versichert. Die Beiträge werden mindestens zur Hälfte durch den Arbeitgeber und über Lohnabzüge durch den Arbeitnehmenden finanziert. Diese Beiträge werden nicht zum Nettolohn auf dem Lohnausweis dazugezählt und werden somit «steuerfrei» verdient.
Selbständigerwerbende sind nicht obligatorisch BVG-versichert, können sich jedoch freiwillig einer Pensionskasse anschliessen. Hier liegt ein grosser Gestaltungsspielraum vor. Es kann definiert werden, welcher Lohnteil versichert ist. Zudem kann man die Höhe der Risikoleistungen und der Altersgutschriften wählen.
Und vergessen Sie nicht, oft verfügen sowohl Arbeitnehmende wie auch Selbständigerwerbende über Einkaufspotential und Einkäufe können ebenfalls vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden.
Können Sie bitte näher erklären, was mit Einkäufen und Einkaufspotential gemeint ist?
Das Einkaufspotential ergibt sich aus dem maximal möglichen Sparguthaben, welches jemand erreichen kann, sofern er seit Beginn (in der Regel Alter 25) mit dem aktuellen Lohn versichert gewesen wäre und Beiträge bezahlt hätte. Häufig ist das effektive Sparguthaben kleiner, wobei man die Differenz als Einkaufspotential bezeichnet. Sie finden diesen Wert in der Regel auf Ihrem Vorsorgeausweis.
Ein Einkauf ist eine freiwillige Zahlung mit dem Zweck, diese Lücke zu füllen. Es gilt vor jedem Einkauf verschiedene Punkte zu berücksichtigen.
Können Sie diese unseren Leserinnen und Lesern detaillierter erklären?
Einerseits ist ein Einkauf nur möglich, solange Einkaufspotential vorhanden ist. Vom vorher beschriebenen Einkaufspotential sind Freizügigkeitsguthaben bei anderen Stiftungen abzuziehen sowie unter Umständen grössere Guthaben der Säule 3a zu berücksichtigen.
Weiter muss ein Einkauf auch mit einem Kapitalbezug koordiniert werden. Innerhalb von drei Jahren darf nach einem Einkauf das Vorsorgeguthaben nicht in Kapitalform bezogen werden, da ansonsten die steuerlichen Effekte wieder aufgerechnet werden.
Zudem sind Vorbezüge für Wohneigentum vor einem Einkauf zurückzuführen. Sie sehen, es gilt eine Menge zu beachten, weshalb wir empfehlen, vor einem Einkauf den Finanz- und Vorsorgeplaner zu kontaktieren. Zudem verlangen Pensionskassen heute in der Regel ein Formular, welches vor der Einzahlung eingereicht werden muss.
Sie haben eingangs auch die 3. Säule erwähnt. Was ist damit gemeint?
Im Schweizer 3-Säulen-Konzept versteht man unter der 3. Säule die private individuelle Vorsorge. Sie unterteilt sich in die freie Vorsorge sowie in die gebundene Vorsorge – auch Säule 3a genannt. Alle Personen mit einem AHV-pflichtigen Erwerbseinkommen dürfen Beiträge an die Säule 3a leisten, welche vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden dürfen. Sehen Sie dazu unser Berechnungsbeispiel in der Infobox. Für BVG-versicherte beträgt der jährliche Maximalbeitrag CHF 7'056.- sowie für nicht BVG-versicherte 20 % des AHV-pflichtigen Einkommens, maximal jedoch CHF 35'280.-.
Solche Steuergeschenke gibt es in der Regel nicht gratis. Was sind die Nachteile der Säule 3a?
Ich würde dies nicht direkt als Nachteile bezeichnen, aber die individuellen Möglichkeiten sind in der gebundenen Vorsorge eingeschränkt. So kann das Guthaben nur unter bestimmten Voraussetzungen wieder bezogen werden. Darunter fällt das Erreichen des Pensionsalters resp. 5 Jahre davor, Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum, die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder das endgültige Verlassen der Schweiz. Guthaben der Säule 3a zählen im Todesfall nicht in die Erbmasse und werden nach einer separaten Rangreihenfolge verteilt, worauf man nur teilweise Einfluss nehmen kann.
Berechnungsbeispiel Steuereinsparung
Beispiel Säule 3a: Ehepaar, konfessionslos, Kantonshauptort, Einkommen 160'000, 3a 7'056
Beispiel BVG-Einkauf: Ehepaar, konfessionslos, Kantonshauptort, Einkommen 330'000, BVG-Einkauf 40'000
Quelle: Eigene Berechnungen mit dem Steuerrechner von Logismata
Wie sieht es bezüglich der Wahl der Anlageform aus? Was ist hier möglich?
Die gebundene Vorsorge wird sowohl von Banken wie auch Versicherern angeboten. Zudem ist von einer Sparkontolösung bis zu einer Aktienstrategie alles möglich. Je nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen finden wir so die passende Lösung für jeden Kunden.
Nun haben wir lange über Steuerabzüge gesprochen. Ich finde es aber wichtig, auch über die Besteuerung bei der Auszahlung zu reden. Wie sehen Sie das?
Ich gebe Ihnen da völlig recht. Der Bezug einer BVG-Altersrente muss zu 100 % im Einkommen versteuert werden. Ob dies steuerlich attraktiv ist, hängt von verschiedenen Faktoren wie dem Steuertarif im jeweiligen Kanton oder den weiteren steuerbaren Einkommen ab. Anders sieht es bei Kapitalbezügen aus, sowohl aus dem BVG wie auch der Säule 3a. Diese unterliegen einer separaten Steuer, werden also getrennt vom übrigen Einkommen versteuert. Die Kantone wenden dazu separate Steuertarife an, wobei diese ungefähr bei einem Fünftel der Einkommenssteuer liegen. Wichtig ist, dass alle Kapitalbezüge aus dem BVG und der Säule 3a innerhalb eines Steuerjahres zusammengerechnet werden, was es in einer Finanzplanung zu berücksichtigen gilt.
Bitte erläutern Sie das.
Mit dem Kapitalbezug schliesst sich der Kreis der Steueroptimierung. Langfristig geplant und vorbereitet kann beispielsweise das Pensionskassenguthaben der Ehefrau und des Ehemannes in zwei unterschiedlichen Kalenderjahren bezogen werden. Oder das Guthaben wird mittels Teilpensionierungsschritten bezogen. Auch in der Säule 3a sind mehrere Vorsorgetöpfe möglich, die dann unabhängig bezogen werden können.
Besten Dank für Ihre Ausführungen. Haben Sie zum Abschluss noch einen Tipp für unsere Leserschaft?
Lassen Sie sich unbedingt frühzeitig und umfassend beraten. Unsere Beraterinnen und Berater stehen Ihnen dazu in der ganzen Schweiz persönlich vor Ort zur Verfügung.
Vorsorgeauftrag/Patientenverfügung
Seit gut 10 Jahren ist der Vorsorgeauftrag ein Dauerbrenner. Man könnte meinen, dass das Thema so langsam an Aktualität verliert. Dem ist nicht so.
In den letzten Jahren haben die vorwiegend negativ behafteten Medienberichte abgenommen, doch noch immer gibt es viele Leute, welche das Thema für sich noch nicht geregelt haben. Mit der Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz (ZGB Art. 360 – 459) am 01.01.2013 wurde das Vormundschaftsrecht abgelöst. Darin regelt der Bund die minimalen Vorgaben bezüglich der Umsetzung sowie deren Organisation. Somit wird beispielsweise festgelegt, dass die zuständige Stelle eine Fachbehörde, die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), sein muss. Der Aufbau und die Umsetzung des Kindes- und Erwachsenenschutzes, liegt jedoch in der Kompetenz der Kantone, welche Ihre Bestimmungen in Einführungsgesetzen sowie dazugehörige Verordnungen erlassen haben.
Welche Ziele wurden mit der Einführung des neuen Gesetzes verfolgt
Früher wurde der Kindes- und Erwachsenenschutz auf Stufe Gemeinde organsiert und vielerorts durch Laien umgesetzt. Durch eine Zentralisierung sollen die Fallzahlen und damit die Erfahrung der zuständigen Stellen erhöht und dadurch eine Professionalisierung der Behörde (KESB) erreicht werden. Mit der Einführung der neuen Instrumente wie bspw. Vorsorgeauftrag oder Patientenverfügung soll die Selbstbestimmung und die Eigenverantwortung gefördert und das Mitspracherecht der Familie gestärkt werden. Das Mitwirkungsrecht der Familie beschränkt sich jedoch auf die Vertretung der Ehegatten bei Rechtshandlungen zur Deckung des Unterhaltsbedarfs, die ordentliche Verwaltung des Einkommens und der Vermögenswerte und nötigenfalls der Befugnis zur Öffnung der Post sowie das Vertretungsrecht von Angehörigen und Ehegatten bei medizinischen und pflegerischen Fragen. Weiter soll durch eine individuell zugeschnittene Beistandschaft von Gesetzeswegen nur so weit wie nötig, dem Einzelfall entsprechend, eingegriffen werden (4 Arten: Begleitbeistandschaft, Vertretungsbeistandschaft, Mitwirkungsbeistandschaft und umfassende Beistandschaft).
Zuständigkeit: die neue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
Je nach Kanton ist die KESB ein Gericht oder eine gerichtsähnliche Behörde mit dem Auftrag, im Erwachsenenschutz die wichtigen Entscheidungen zu treffen, Massnahmen anzuordnen und entsprechend zu überwachen. Eine KESB besteht jeweils aus mindestens 3 Behördenmitglieder. Jedes dieser Mitglieder ist für einen Bereich verantwortlich. Davon muss mindestens ein Vertreter der Fachrichtung Recht und Soziale Arbeit mit mehrjähriger Berufserfahrung vertreten sein. Entscheide werden jeweils von drei KESB-Mitgliedern gefällt. Nur wenige Fragen dürfen von einem KESB-Mitglied allein entschieden werden. Für jeden Entscheid muss die KESB ein Entscheidungsverfahren durchführen und trifft mithilfe von KESB-Mitarbeitern, Sozialdiensten und Gutachtern die für einen Entscheid notwendige Abklärungen. Dabei steht die Vermittlung von freiwilliger Hilfe im Vordergrund. Das Ziel ist es, mit den Betroffenen eine einvernehmliche Lösung zu finden. Das Begleiten und Betreuen von Betroffenen im Alltag ist nicht die Aufgabe der KESB. Diese Arbeiten werden von Beiständen, Sozialdiensten, Institutionen wie bspw. Alters- und Pflegeheime und Beratungsstellen erbracht.
Wann greift das Gesetz
Grundsätzlich sind erwachsene Personen für sich selbst verantwortlich und in der Lage über ihre Zukunft selbst zu entscheiden. Sie können somit durch ihre persönlichen Handlungen Rechte und Pflichten begründen. Nach der schweizerischen Gesetzgebung wird dies als Handlungsfähigkeit bezeichnet. Voraussetzungen zur Handlungsfähigkeit sind, volljährig und urteilsfähig zu sein (Art. 13 ZGB). Somit ist im Sinn des ZGB jede Person handlungsfähig, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftmässig zu handeln.
Durch den Verlust bzw. Teilverlust der Urteilsfähigkeit ist eine der beiden Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit nicht mehr gegeben. Somit ist es der Person nicht mehr zu hundert Prozent möglich, die Selbstverantwortung wahrzunehmen. Ab hier greift auf Anzeigen hin die KESB zum Schutz der betroffenen Erwachsenen Person ein.
Welche Instrumente kennt das Erwachsenenschutzrecht
- Private Vorsorge: Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung
- Gesetzliche Vertretung: Ehegatte für die Alltagsgeschäfte und Angehörige zur Mitsprache bei medizinischen Fragen
- Beistandschaft
Was gilt ohne Vorkehrungen
Die neue gesetzliche Regelung des Erwachsenenschutzes beabsichtigt die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts von einer urteilsunfähigen Person. Durch die grössere Freiheit bei der Mitbestimmung steigt jedoch auch die Eigenverantwortung die entsprechenden Vorkehrungen frühzeitig zu treffen und einen Vorsorgeauftrag sowie eine Patientenverfügung aufzusetzen. Denn durch den Eintritt der Urteilsunfähigkeit erlischt auch die Möglichkeit dieser Mitbestimmung. Leider kann dieser Zeitpunkt jederzeit und völlig unerwartet eintreten. Sollten sie keine Vorkehrungen getroffen haben, kommen die gesetzlichen Vertretungsrechte zum Tragen.
Vertretungsrecht der Ehegatten
Falls kein Vorsorgeauftrag besteht, besitzt bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit einer Person deren Ehegatte oder eingetragene Partner, welcher mit der betroffenen Person im gemeinsamen Haushalt lebt oder zumindest regelmässig persönlich Beistand leistet von Gesetz ein Vertretungsrecht. Dieses Recht ist jedoch auf folgende Handlungen beschränkt:
- Rechtshandlungen, welche zur Deckung des Unterhaltsbedarfs üblicherweise notwendig sind
- Die ordentliche Verwaltung des Einkommens und der übrigen Vermögenswerte
- Nötigenfalls die Befugnis, die Post zu öffnen oder zu erledigen
Auf den ersten Blick erscheinen die vorgesehenen Handlungen als ausreichend, bei näherer Betrachtung ist dadurch im Alltag eine Betreuung nur sehr eingeschränkt möglich. Sämtliche weiterführende Handlungen müssen zuerst vorgängig von der KESB abgesegnet werden. Als weiterführende Handlungen gelten bspw. bereits: Hypothekenerhöhungen, Vermietung und Verkauf von Liegenschaften, Übernahme oder Liquidation eines Geschäfts etc. Im Zweifelsfall muss also stets die Behörde um vorgängige Zustimmung angefragt werden.
Vertretung bei medizinischen Massnahmen
Hat die urteilsunfähige Person keine Patientenverfügung verfasst, wird die Behandlung durch die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt unter Beizug der zur Vertretung berechtigten Person geplant. Selbstverständlich wird soweit möglich auch die urteilsunfähige Person in den Entscheidungsprozess einbezogen. Gemäss Gesetz sind folgende Personen der Reihe nach berechtigt, die urteilsunfähige Person zu vertreten und den vorgesehenen ambulanten oder stationären Massnahmen zuzustimmen oder zu verneinen:
- Die Person, welche in einer Patientenverfügung oder Vorsorgeauftrag bezeichnet ist
- Der Beistand mit einem Vertretungsrecht bei medizinischen Massnahmen
- Der als Ehegatte oder eingetragener Partner einen gemeinsamen Haushalt mit der urteilsunfähigen Person führt oder ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet
- Die Person, die mit der urteilsunfähigen Person einen gemeinsamen Haushalt führt
- Die Nachkommen, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig Beistand leisten
- Die Geschwister, wenn sie der urteilsunfähigen Person regelmässig persönlich Beistand leisten
Auch wenn das Recht Vertretungsrechte für Ehepartner und deren gleichberechtigten eingetragenen Partnerschaften sowie Familienangehörigen vorsieht, sind diese mehr oder weniger beschränkt. Ebenfalls sind im Gesetzestext nicht einzelne Handlungen konkret beschrieben, sondern nur Handlungsgebiete festgehalten, welche Interpretationsspielraum zulassen. Im Zweifelsfall folgt dann immer eine Entscheidung durch die KESB.
Ob dieser Entscheid auch dem Willen der urteilsunfähigen Person entspricht ist insofern fraglich, da der Entscheid von einer Behörde gefällt werden muss, welche keine persönliche Beziehung zur entsprechenden Person hat. Auf jeden Fall ist zu empfehlen, sich nicht auf das gesetzliche Vertretungsrecht zu verlassen. Wenn man sicher gehen will, dass auch im Fall der Urteilsunfähigkeit in eigenem Sinne entschieden wird, sollte man dies in einem Vorsorgeauftrag und einer Patientenverfügung festhalten.
Vollmachten und deren Hinfälligkeit
Vollmachten legitimieren Beauftragte gewisse Rechtsgeschäfte anstelle des Auftraggebers vorzunehmen. Vollmachten werden durch deren Ausstellung gültig und sind entgegen dem Vorsorgeauftrag nicht an ein Ereignis (Eintritt der Urteilsunfähigkeit) gebunden. Vollmachten, welche bereits gültig sind und in denen explizit erwähnt wird, dass diese auch weiter gelten sollen falls der Vollmachtgeber urteilsunfähig geworden ist, bleiben auch nach dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht gültig, auch dann noch, wenn die Urteilsunfähigkeit eintritt. Hingegen ist es nicht mehr möglich, Vollmachten zu erteilen, welche erst ab Eintritt der Urteilsunfähigkeit ihre Gültigkeit erlangen. Dies ist nur mit einem Vorsorgeauftrag möglich, der vor Eintritt der Urteilsunfähigkeit erstellt wurde. Da die Praxis bezüglich bestehender Vollmachten keine einheitliche Handhabung zeigt und die Unterschiede in den kantonalen Auslegungen sehr gross sind, sollte eine bereits bestehende Vollmacht zusätzlich durch einen Vorsorgeauftrag abgesichert werden.
Einrichtung des Vorsorgeauftrages
Wie anfangs erwähnt, setzt die Errichtung eines Vorsorgeauftrages die Handlungsfähigkeit voraus. Somit muss die Person, die einen Vorsorgeauftrag errichten möchte, im Zeitpunkt der Errichtung volljährig und urteilsfähig sein. Es gibt zwei Möglichkeiten einen Vorsorgeauftrag gültig zu errichten. Entweder wird er komplett von Hand geschrieben, datiert und unterzeichnet oder aber durch einen Notar öffentlich beurkundet. Ohne Einhaltung dieser Formvorschriften kann der Vorsorgeauftrag nicht für wirksam erklärt werden. Im Vorsorgeauftrag müssen Aufgaben, die der oder den beauftragten Personen übertragen werden sollen, möglichst klar umschrieben werden. Je genauer die Instruktionen festgehalten werden, desto einfacher können die Beauftragten den Auftrag ausführen.
Als Beauftragte kommen sowohl natürliche wie auch juristische Personen in Frage. Es können auch mehrere Personen eingesetzt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Zuständigkeiten klar abgegrenzt sind, um Streitereien vorzubeugen. Bei mehreren Personen wird empfohlen die einzelnen Aufgabenbereiche aufzuteilen. Im Vorsorgeauftrag können die Bereiche Personensorge (alles was mit der Persönlichkeit zusammenhängt, z. B. Fragen betreffend Wohnen, das Öffnen der Post, Vertretung bei medizinischen Belangen), Vermögenssorge (Zahlungsverkehr, Verwaltung des Vermögens, Verkehr mit Banken) und die Vertretung im Rechtsverkehr (Vertretung gegenüber Behörden, Gerichten und Privaten) geregelt werden. Speziell erwähnt werden müssen bspw. Kontosaldierungen und der Zugriff zu Bankschliessfächern, die Veräusserung oder Belastung von Grundstücken, das Ausrichten von Schenkungen etc. (siehe auch Art. 396 Abs. 3 OR).
Der Vorsorgefall
Tritt die Urteilsunfähigkeit ein, ist folgendes Vorgehen vorgesehen:
- Prüfen ob die urteilsunfähige Person ein Vorsorgeauftrag erstellt hat
- Einreichen des Vorsorgeauftrages an die zuständige KESB
- Prüfung (Validierung) des Vorsorgeauftrages durch die KESB
- Gespräch zwischen der KESB und dem oder den Beauftragten
- Mandatsannahme durch die Beauftragten
- Ausstellung der Legitimationsurkunde für die Beauftragten durch die KESB
Erst nach erfolgter Validierung und entsprechender Ausstellung der Legitimationsurkunde durch die KESB erlangt der Vorsorgeauftrag seine Wirksamkeit. Bei der Validierung prüft die KESB, ob der Vorsorgeauftrag gültig errichtet wurde, die Urteilsunfähigkeit tatsächlich eingetreten ist, ob die beauftragte Person geeignet und bereit ist den Auftrag anzunehmen. Um die Eignung der vorsorgebeauftragten Person festzustellen führt die KESB mit dieser ein persönliches Gespräch und überprüft den Straf- und Betreibungsauszug. Sind die Voraussetzungen erfüllt, wird die Legitimationsurkunde mit Angabe der beauftragten Personen sowie deren Befugnisse und Aufgaben ausgestellt. Damit endet grundsätzlich der Kontakt zur Behörde. Die KESB hat somit keine Pflicht zur dauernden Überwachung der Beauftragten. Eine solche müsste als Regelung im Vorsorgeauftrag entsprechend vorgesehen werden. Dieses Vorgehen entspricht dem im Gesetz vorgesehenen Ablauf.
Aufgaben der beauftragten Person
Sofern die beauftragte Person den Auftrag (Auftragsrecht) annimmt, müssen die im Vorsorgeauftrag bezeichneten Geschäfte unter Berücksichtigung der Weisungen des Auftraggebers im umschriebenen Rahmen besorgt werden. Grundsätzlich sind die Aufgaben persönlich zu erfüllen. Es können bei Bedarf jedoch Hilfspersonen zugezogen werden. Der Vorsorgebeauftragte kann den Auftrag mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten kündigen. Die Bestimmungen über den einfachen Auftrag sind anwendbar, soweit das ZGB nicht abweichende Bestimmungen festhält. Damit sichergestellt ist, dass die beauftragte Person das übertragene Vertrauen nicht missbraucht und die übernommenen Aufgaben ordnungsgemäss ausführt, bleibt jederzeit ein Mindestmass an behördlicher Eingriffsmöglichkeit bestehen. Die KESB kann jederzeit auf Antrag oder von Amtes wegen, die erforderlichen Massnahmen ergreifen. Wie bereits erwähnt, können aber auch im Vorsorgeauftrag Kontrollmechanismen vorgesehen werden (Bspw. eine regelmässige Berichterstattung und Rechenschaftsablage an bezeichnete Personen oder die KESB).
Zusammenfassung und Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Instrumenten
Vorsorgeauftrag
Personen- und Vermögenssorge sowie die Vertretung im Rechtsverkehr
Handschriftlich oder mit notarieller Beurkundung
Auftrag an natürliche und juristische Person möglich
Zum Errichten muss die Person volljährig und urteilsfähig sein
Hinterlegung beim Zivilstandsamt möglich (je nach Kanton)
Patientenverfügung
Begrenzt auf medizinische Fragen
Schriftlichkeit ausreichend – kann somit auf Computer geschrieben und anschliessend unterzeichnet werden
Zum Errichten muss die Person urteilsfähig sein
Auftrag nur an natürliche Person möglich
Hinterlegung auf Krankenkassenkarte und Hausarzt möglich, viele Vorlagen haben eine Hinweiskarte auf eine Patientenverfügung in Kreditkartengrösse zum Aufbewahren im Portemonnaie (empfohlen, da diese im Falle eines Unfalls schnell gefunden werden kann)
Ehegattenvertretung
Vertretung in sehr beschränktem Umfang möglich (Alltagsgeschäfte)
Genaue gesetzliche Umschreibung fehlt
Rechtssicherheit in der Praxis fraglich
Vollmacht
Gültigkeit ab Erstellung
Begrenzung der Gültigkeit auf den Zeitpunkt der Urteilsunfähigkeit nicht möglich
Durchsetzbarkeit bei einer Urteilsfähigkeit in der Praxis fraglich, auch wenn dies explizit in der Vollmacht vorgesehen wurde
Willensvollstreckung
Verfügung auf den Tod
Vollmacht (Urteilsfähigkeit) – Vorsorgeauftrag (Urteilsunfähigkeit) – Willensvollstreckung (Tod)
Fazit
Zur bestmöglichen Absicherung der meisten Lebenslagen wird somit das umfassende Paket mit der Vollmacht, dem Vorsorgeauftrag, einer Patientenverfügung und einem Testament empfohlen.
Zur Person
Christoph Lautenschlager ist Dipl. Treuhandsexperte
TBO Treuhand AG*
Steinstrasse 21
8036 Zürich
Telefon 044 457 15 75
mail@fmhtreuhand.ch
www.fmhtreuhand.ch
*TBO Treuhand AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Deckungslücken bei Erwerbsunfähigkeit vermeiden
Wir zeigen in diesem Artikel auf, wie das Zusammenspiel der Sozialversicherungen funktioniert und welche Möglichkeiten es gibt, die individuelle Vorsorgesituation zu verbessern.
Die finanzielle Absicherung gegen die Folgen einer Erwerbsunfähigkeit ist ein wichtiges Thema für alle Berufstätigen. Insbesondere Ärztinnen und Ärzte müssen diesem Thema eine hohe Aufmerksamkeit widmen, da oft ihre Einkommen nur ungenügend versichert sind.
Im Schweizer Versicherungssystem gibt es mehrere Sozialversicherungen, die Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit erbringen. Die versicherten Einkommen resp. die daraus resultierenden Rentenleistungen sind limitiert:
Invalidenversicherung (IV)
Die Invalidenrente der IV ist abhängig vom sogenannten massgebenden Durchschnittseinkommen. Dies entspricht vereinfacht dem erzielten Durchschnittseinkommen plus Erziehung- und Betreuungsgutschriften. Ohne Fehljahre beträgt die IV-Rente maximal CHF 29'400 pro Jahr (ab einem Durchschnittseinkommen von CHF 88'200). Zusätzlich wird pro Kind bis 18 Jahre (resp. 25 Jahre bei Ausbildung) eine IV-Kinderrente von max. CHF 11'760 vergütet.
Berufliche Vorsorge (BVG)
Die Invalidenrente einer Pensionskasse hängt vom jeweiligen Vorsorgeplan ab. Während die obligatorische gesetzliche Minimal-Lösung für Arbeitnehmende nur den Lohnteil zwischen CHF 25'725 (Koordinationsabzug) und CHF 88'200 versichert, kann bei einer überobligatorischen Lösung der gesamte Lohn bis CHF 882'000 versichert werden. Die Höhe der IV-Rente berechnet sich entweder aufgrund des Altersguthabens oder in % des versicherten Lohnes. Die BVG-Invalidenrente wird primär infolge Krankheit bezahlt und ergänzt subsidiär die Leistungen bei Unfall. Auch von der Pensionskasse erhalten Eltern Kinderrenten.
Unfallversicherung (UVG)
Die obligatorische Unfallversicherung deckt den Lohn bis max. CHF 148'200, wobei die IV-Rente 80 % des Lohnes respektive max. 90 % zusammen mit der 1. Säule abdeckt. Höhere Löhne können durch den Arbeitgeber in Form einer Unfall-Zusatzversicherung abgedeckt werden, wobei hier nicht zwingend IV-Renten gedeckt sind.
Zwei Beispiele aus der Praxis
Wie Sie sehen, ist die Berechnung der eigenen Versicherungsdeckung von zahlreichen Faktoren abhängig und sehr komplex. Wir haben deshalb zur besseren Veranschaulichung folgend zwei Praxisbeispiele aufgeführt.
Oberärztin in einem Kantonsspital, 46-jährig, 2 Kinder, Lohn CHF 185'000
Ophthalmologe mit eigener Praxis, 51-jährig, keine Kinder, Lohn CHF 350'000, selbständig mit Pensionskasse aber ohne UVG
Vorsorgesituation verbessern
Wie Sie anhand der beiden Beispiele sehen, können rasch grosse Deckungslücken entstehen. Um diese zu schliessen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Pensionskasse
Selbständigerwerbende oder Firmeninhaber können ihre Pensionskassenlösung selbst bestimmen. So können Sie definieren, welche Lohnteile versichert sind und wie hoch die Invalidenrente ist. Je nach Anbieter kann die IV-Rente bis 70 % des versicherten Lohnes betragen. Toller Nebeneffekt: Die Prämie der Pensionskasse reduziert das steuerbare Einkommen und somit die Steuerlast.
Private Erwerbsunfähigkeitsrente
Mit einem Invaliditäts-Taggeld oder einer Lebensversicherung können Sie sich über die private Vorsorge versichern. Sowohl im kurzfristigen wie auch im langfristigen Bereich gibt es interessante Lösungen zur idealen Ergänzung der 1. und 2. Säule. Hier gilt es jedoch genau zu prüfen, wie die Versicherungsdeckung ausgestaltet ist (Summen- oder Schadensversicherung) und einen Prämienvergleich einzuholen, da es teilweise grosse Differenzen gibt.
Zusammenfassung
Das Schweizer Drei-Säulen-System bietet zwar verschiedene Versicherungsleistungen bei Erwerbsunfähigkeit. Jedoch reichen diese häufig, insbesondere bei Besserverdienenden, nicht aus. Es gilt deshalb die eigene Vorsorgesituation sorgfältig zu analysieren um Deckungslücken erkennen und schliessen zu können. Dafür empfehlen wir Ihnen die unabhängige Beratung durch unser Spezialisten-Team. Wir zeigen Ihnen auf, welche Leistungen Sie bei Erwerbsunfähigkeit erhalten würden, berechnen Ihnen Offerten für die individuelle Ergänzung und unterstützen Sie beim Vertragsabschluss.
Klare Aussensicht zur Optimierung von Prozessen
Spitäler bieten immer mehr ambulante Leistungen an. Unter diesen Aspekten sind nun viele Spitäler übergegangen, Praxen zu kaufen und damit noch vermehrt im ambulanten Bereich tätig zu werden.
Zum Einen ist das dem Trend «ambulant vor stationär» zuzuschreiben. Zum Anderen sehen sich die Spitäler immer mehr mit Anfragen niedergelassener Ärzte konfrontiert, deren Praxis zu übernehmen. In diesem Umfeld müssen die Spitäler das Überlaufen der Notfallabteilungen, immer mehr Praxisschliessungen im Einzugsgebiet, das Abdecken des Zuweisungsnetzes, den ausgeprägten Kostendruck usw. meistern. Unter diesen Aspekten sind nun viele Spitäler übergegangen, Praxen zu kaufen und damit noch vermehrt im ambulanten Bereich tätig zu werden. Diesen Aspekt hat die FMH Consulting Services AG im Fokus und optimiert im Interesse ihrer Kunden.
«Eine oft gehörte Reaktion von praxistätigen Ärzten, bei welchen die Nachfolgesuche nach längerer Zeit nicht erfolgreich war: Ich frage den Chefarzt der umliegenden Spitäler an, ob er meine Praxis übernehmen will», erzählt Patrick Tuor, lic.rer.pol., Leiter Beratung und Mitglied der Geschäftsleitung FMH Consulting Services AG. Viele Spitäler prüfen mittlerweile diese Angebote, weil sie damit auch die oben erwähnten Probleme lösen können. In der Beratung sieht Patrick Tuor allerdings, dass für die Spitäler mit Praxisübernahmen die Herausforderungen eher zunehmen als dass sie gelöst wären.
Zuerst braucht es für den abtretenden Arzt oder die Ärztin eine Nachfolgelösung. Dann kommen auch Fragen, wie man diese Praxis in die bestehende Struktur eines Spitals integriert. Denn gerade hinsichtlich Praxisaspekten hat man nicht bei allen Fragen Spezialisten inhouse. Andererseits gibt es natürlich auch bestehende ambulante Abteilungen innerhalb eines Spitals, welche gemäss persönlichen Erfahrungen von Patrick Tuor wie auch aufgrund publizierter Artikel zu diesem Thema mit der Rentabilität kämpfen. Patrick Tuor erläutert, dass mit einfachen Methoden aus der Praxis und Ansätzen, welche sich entsprechend bewährt haben, die Rentabilität und auch mögliche Unzufriedenheiten bei Mitarbeitern etc. oft lösen lassen. Er nennt dabei als Beispiel die ambulante Anästhesie in einem Spital: «Das persönliche Wohlbefinden und eine erstklassige Vorbereitung der Patientinnen und Patienten auf kommende Eingriffe in der Region sind entscheidend. Gründliche Information und Aufklärung über Operationen, stationäre Aufenthalte und Weiterbehandlungen sind daher Gold wert. Und das kann aufwändig und zeitintensiv sein. Gut zu wissen, wo es Optimierungspotenzial gibt, um die klinikinternen Ressourcen bestens einsetzen zu können.» Was bringen hier eine unabhängige Sichtweise sowie eine Angleichung der spitalinternen Prozesse?
Das Universitätsspital Basel (USB) ist ein anschauliches Beispiel. Hier präsentierte sich vor rund einem Jahr folgende Ausgangslage: Die Klinik Anästhesiologie bot präoperative Sprechstunden für ambulante und stationäre Eingriffe und Interventionen an. Dabei wurden Patienten in der ambulanten Sprechstunde sowie auf den chirurgischen Stationen betreut. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und den Patienten aus der stationären Versorgung entstanden verschiedene Herausforderungen, die einen organisatorischen Mehraufwand auslösten.
Stehenbleiben hiesse Rückschritt
Mitarbeitende einer Klinik oder auch einer Praxis wollen den Erfolgspfad nachhaltig beschreiten. Natürlich kennen sie sämtliche Abläufe von Grund auf und versuchen ständig, den Bedürfnissen ihrer Patientinnen und Patienten gerecht zu werden. Das ist jedoch bloss die eigene Sicht der Dinge. Daher kann eine Sichtweise von aussen sehr vorteilhaft sein. Aus diesem Grund entschied z.B beim USB die Klinikleitung als weiteren Schritt, Stärken und Schwächen durch eine externe Spezialistenfirma analysieren zu lassen, mit dem Ziel, die Prozesse zu beurteilen, weiteres Verbesserungpotenzial herauszuarbeiten wie auch positive Faktoren zu erkennen.
Dafür wurde FMH Consulting Services AG beauftragt. Ausschlaggebend für diese Wahl war die Tatsache, dass diese Expertinnen und Experten in der ambulanten Versorgung versiert sind und auf eine breite und lange Erfahrung zurückblicken können. Während zwei halben Tagen wurden daher die Sprechstunden begleitet und analysiert sowie Mitarbeitende verschiedener Abteilungen und Patientinnen und Patienten befragt. Ebenfalls wurde für die Analyse Datenmaterial zur Verfügung gestellt und Befragungen der Klinikleitung miteinbezogen. Aus diesen Gesprächen und den Erfahrungen aus den Sprechstunden sowie den ausgewerteten Daten haben die FMH Consulting Services AG einen Bericht in Form eines Protokolls erarbeitet, welcher intern besprochen und dessen Vorschläge priorisiert wurden.
Ein typisches Beispiel für eine Praxisberatung im Spital
Die Aufgabenstellung im USB ist charakteristisch für Projekte, welche die FMH Consulting Services AG im Auftrag von Spitälern bearbeitet. Diese profitieren dabei von der jahrzehntelangen Erfahrung der FMH Services Spezialisten im rein ambulanten Bereich. Ambulante Prozesse bilden immer bedeutungsvolle Elemente im Klinikalltag. Es lohnt sich im Zeichen des Fachkräftemangels und vielfach nicht befriedigender Tarife sorgfältig zu analysieren, Verbesserungspotenzial zu sichten, daraus folgende Massnahmen gezielt umzusetzen und bei den Spital-Mitarbeitenden für eine hohe Akzeptanz zu sorgen. An dieser Stelle werden wir laufend weitere erfolgreich realisierte Projekte präsentieren.
Ein erstaunliches Inventar an Chancen
Grundsätzlich gibt es viele Faktoren, folgende häufig vorkommende Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge lassen sich aufführen:
- Sprechstundenplanung: Wie kann ich Wartezeiten verhindern oder wie sollten die optimalen Zeitintervalle sein?
- Wo hat man aus Sicht eines Benchmarkings Optimierungspotenzial gegenüber anderen Praxen in einer vergleichbaren Situation?
- Planung der Patienten auf das Zimmer, den Arzt: Was eignet sich besser?
- Aus externer Sicht eine Verbesserung der Patientenwege suchen: Findet sich der Patient zurecht und hat die MPA den Überblick?
- Eine Optimierung der Beschriftung durch einfache Möglichkeiten installieren: Findet der Patient in nützlicher Frist die Praxis?
- Wie ist das Abgabemanagement bei Medikamenten bei Praxen mit Selbstdispensation?
- Aufbereiten von einfachen Unterlagen oder Checklisten für die Mitarbeitenden, gerade auch hinsichtlich neuen Mitarbeitenden und Assistenzärzten in den ambulanten Abteilungen: Wie kann die Kommunikation optimiert werden?
- Die Frage der Abrechnungssoftware nochmals hinterfragen
- Optimale Personalbesetzung: Was ist das richtige MPA-Arzt-Verhältnis?
- Effiziente Zusammenarbeit mit den Spitalabteilungen
- und vieles andere mehr
Schrittweise zügige Umsetzung
Die grosse Aufgabe besteht jeweils darin, nach einer gründlichen Aufnahme und Erarbeitung neuer Massnahmen, diese Pläne und Prozesse auch umzusetzen. Gerade in diesem Bereich erden oft Abstriche gemacht, da man wieder ins Tagesgeschäft übergeht. Meistens macht es daher Sinn, dass die Massnahmen ebenfalls begleitet und idealerweise nach einer bestimmten Zeit nochmals überprüft werden. Die Mitarbeitenden und insbesondere in dieser Frage die MPA sind jeweils sehr interessiert und freuen sich sehr auf die daraus resultierenden Resultate punkto Effizienz und speziell kundenorientierter Massnahmen. Denn beides ist gleichermassen entscheidend. «Die Patientinnen und Patienten haben erste Priorität, aber neue Strukturen und Abläufe müssen auch ausgezeichnet zu den Mitarbeitenden passen. Stimmt beides, gewinnen alle und die beidseitige Zufriedenheit stimuliert und motiviert», hält Patrick Tuor fest. «Bereits wenige Monate nach dem Start einer Umsetzung stellen wir gerne fest, dass das Zusammenwirken von internem Knowhow und Out-of-the-box-Sicht von unserer Seite eine ideale Kombination bedeutet. Voraussetzung dafür ist, dass beide Partner ihr Wissen und ihre Ideen gemeinsam offen diskutieren und verbinden konnten. Das ist für die Qualität wie auch die Akzeptanz solcher Projekte ausschlaggebend.»
Eine herausfordernde Zusammenarbeit
Für Patrick Tuor verlaufen viele Aufträge positiv: «Wir stossen immer wieder auf spannende Projekte, für das sich die Mitarbeitenden sehr aktiv mit einbringen und neugierig auf weitere Verbesserungsmassnahmen sind. Zudem können wir jeweils die Mitarbeitenden wie auch die MPA oder angestellte Ärzte und Ärztinnen sehr gut ins Projekt integrieren. Sie sollen Teil der Anpassungen sein und ihren Input liefern. Zudem sind wir überzeugt, dass wir aufgrund unseres Knowhows bezüglich Organisation, Struktur und Führung ambulanter Einrichtungen wertvolle Erkenntnisse erarbeiten und zu deren Realisation beitragen können. Die Zusammenarbeit ist immer sehr spannend und herausfordernd, gerade auch bei grösseren Instituten wie beim USB mit einem grossen Patientenaufkommen. Das bedeutete natürlich eine enorme Chance, mit einem neuen Konzept besonders viel an Effizienz, Mitarbeitenden- und Patientenzufriedenheit zu erreichen.»
Patrick Tuor
Leiter Beratung / Mitglied der Geschäftsleitung
lic.rer.pol., MAS in Managed Health Care
Sorglos in den Ruhestand
Nach einer hoffentlich erfüllenden und erfolgreichen Zeit als Praxisinhaber/in kommt irgendwann der Zeitpunkt, sich von seiner Tätigkeit zu trennen, die Praxis an einen Nachfolger/in zu übergeben und in den Ruhestand zu treten.
Im Hinblick auf Versicherung und Vorsorge gibt es einige wichtige Dinge, die man beachten muss.
AHV/IV
Bei einer Pensionierung vor dem ordentlichen Rentenalter von 64/65 Jahren sind Sie weiterhin verpflichtet, jährliche Beiträge an die AHV zu leisten. Die Höhe des Betrages berechnet sich bei Nichterwerbstätigen aufgrund des Vermögens. Bei Ehepartnern gilt die Beitragspflicht als erfüllt, wenn ein erwerbstätiger Partner den doppelten Mindestbeitrag einzahlt.
Weiter stellt sich die Frage nach dem Rentenbezug:
Es ist sowohl ein Vorbezug (max. 2 Jahre vor dem ordentlichen Pensionsalter) wie auch ein Aufschub (max. 5 Jahre) möglich. Je nachdem wird die Rente lebenslänglich gekürzt oder erhöht.
Pensionskasse
Mit der Aufgabe der Tätigkeit tritt in der Regel der Vorsorgefall «Pensionierung» ein, wodurch Sie die Möglichkeit haben, Ihr Altersguthaben in Rentenform oder als Kapital zu beziehen. Der Kapitalbezug ist in seltenen Fällen von der Stiftung eingeschränkt, wobei das Gesetz einen minimalen Bezug von 25 % des Kapitals vorsieht. Welche Aufteilung zwischen Rente und Kapital sich lohnt, hängt von der individuellen Situation und von den Wünschen und Zielen der Kundschaft ab. In einer persönlichen Pensionsplanung unterstützen wir Sie in der Definition Ihrer optimalen Strategie.
Berufshaftpflichtversicherung
Die Berufshaftpflichtversicherung endet grundsätzlich mit der Praxisaufgabe. In der Praxis stellen wir häufig fest, dass Ärztinnen und Ärzte mit einem minimalen Pensum weiter tätig sind und so beispielsweise langjährige Patienten, nahe Bekannte oder Familienangehörige weiter beraten und behandeln. In diesem Fall ist es möglich, die Berufshaftpflichtversicherung mit einem minimalen Pensum weiterzuführen, wozu wir Ihnen eine Änderungsofferte erstellen können.
Übrigens: Auch nach der Praxisaufgabe können noch Ansprüche an einen Arzt geltend gemacht werden (aus früheren Behandlungen). Deshalb verfügen unsere Rahmenvertragslösungen über eine kostenlose Nachrisikodeckung, wodurch während den gesetzlichen Verjährungsfristen noch Ansprüche durch die frühere Versicherung gedeckt sind.
Rechtsschutzversicherung
In unseren Versicherungslösungen sind Ärztinnen und Ärzte sowohl in beruflichen Situationen wie auch als Privatperson oder im Strassenverkehr versichert. Mit der Praxisaufgabe kann die Betriebs- und Berufs-Rechtsschutz aus dem Vertrag ausgeschlossen werden, wodurch sich die Prämie reduziert.
Personalversicherungen
In der Funktion als Arbeitgeber verfügten Sie für Ihr Personal über verschiedene Versicherungsdeckungen wie das Krankentaggeld (KTG), die Unfallversicherung (UVG) und die Pensionskasse. Je nachdem, ob das Personal durch einen Nachfolger übernommen wird oder aus dem Unternehmen ausscheidet, bleiben die Verträge bestehen oder können gekündigt werden.
Sachversicherung
Ähnlich sieht es bei der Praxis-Sachversicherung für das Inventar und die Medizinaltechnik aus. Übernimmt die Praxis ein neuer Arzt oder eine neue Ärztin, läuft der Vertrag weiter und geht auf den neuen Versicherungsnehmer über. Diese Handänderung teilen wir in Ihrem Namen dem Versicherer mit, damit der Vertrag entsprechend mutiert werden kann. Dank diesem Vorgehen entsteht in der Übergangsphase kein Versicherungsunterbruch und es besteht stets eine Deckung.
Taggeldversicherung
Ihre persönliche Taggeldversicherung können Sie mit der Pensionierung aufheben. Oftmals reduzieren Kundinnen und Kunden die Deckung bereits in den letzten Jahren vor der Praxisaufgabe, da der Versicherungsbedarf nicht mehr gleich hoch ist.
Zusammenfassend ist es wichtig, sich frühzeitig über die verschiedenen Aspekte im Hinblick auf Versicherung und Vorsorge zu informieren, wenn Sie Ihre Tätigkeit als Arzt oder Ärztin aufgeben.
Gerne beraten und unterstützen wir Sie dabei und helfen Ihnen, sorgenfrei im Ruhestand anzukommen.
Was sagt mir mein jährlicher BVG-Vorsorgeausweis?
Alle im BVG versicherten Personen erhalten jährlich einen aktuellen Vorsorgeausweis zugestellt. Nach unseren Erfahrungen ist oftmals das Zahlenwirrwarr nicht von allzu grossem Interesse.
Zu Unrecht, finden zumindest wir. Hat doch ein grosser Teil der Ärzteschaft einen beachtlichen Teil des Vermögens dieser Anlageform anvertraut. Wir wollten einen genauen Blick auf diesen Vorsorgeausweis werfen und haben Sergio Kaufmann, Geschäftsleitungsmitglied der Roth Gygax & Partner AG*, als langjähriger Vorsorgespezialist in dieser Angelegenheit befragt.
Herr Kaufmann, was können Sie uns generell zum Vorsorgeausweis sagen?
Beim Vorsorgeausweis gibt es sehr viele Detailinformationen. Grob gesagt geht es aber immer um folgende drei Bereiche:
- Altersvorsorge: alles zum Sparprozess mit Informationen zum Kapital- oder Rentenbezug
- Risikoleistungen: welche Leistungen werden bei Invalidität oder im Todesfall fällig
- Finanzierung: was kosten die verschiedenen Bereiche und wer bezahlt was
Wo beginnen wir?
Ich würde mit dem Lohn starten. Es gibt oftmals mehrere aufgeführte Löhne, da im BVG nicht automatisch der AHV-Lohn versichert wird. Zudem können zum Sparen und für die Berechnung der Risikoleistungen zwei unterschiedliche Löhne definiert werden. Gemäss Gesetz muss nur der Lohnanteil zwischen CHF 25'725 (dem Koordinationsabzug) und CHF 88'200 versichert werden. Bei angestellten Ärzten und Ärztinnen z. B. in Spitälern sehen wir oftmals, dass nicht der ganze Lohn versichert ist.
Moment Herr Kaufmann, ist somit ein angestellter Arzt oder eine angestellte Ärztin nicht automatisch ausreichend versichert?
Leider nein. Letzte Woche hatte ich wieder einmal ein gutes Beispiel. Ein 50-jähriger Arzt, welcher rund CHF 300'000 verdient, hatte einen versicherten Lohn von CHF 250'000. Der Sparbeitrag pro Jahr lag bei rund CHF 30'000. Dank verschiedener kleinerer Einkäufe in den letzten Jahren hatte er immerhin schon ein Guthaben von CHF 500'000 angespart. Die Simulation auf dem Vorsorgeausweis ergibt folgendes Bild:
Im ersten Moment sieht das doch recht gut aus. Man bedenke aber, dass weder der Zins noch der Umwandlungssatz, mit welchem die Altersrente berechnet wird, garantiert sind. In den letzten Jahren waren beide Werte massiv unter Druck. Im aktuellen Zinsumfeld wird der Druck sicherlich abnehmen, dafür haben wir aktuell eine Teuerung über dem Verzinsungssatz von 2 %, was die Situation in Zukunft nicht wirklich verbessert.
Und was bedeutet dies nun für diesen 50-jährigen Arzt?
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dieser Arzt aktuell über ein Einkommen von CHF 300'000 verfügt, er im Pensionszeitpunkt zusammen mit der maximalen AHV-Rente aber nur noch über ein Einkommen von CHF 110'000 verfügen wird, fast 2/3 weniger als heute. Da muss eine gute Einkaufsstrategie ergänzt mit der privaten Vorsorge unbedingt geprüft werden.
Auf dem Ausweis unter der Rubrik «Vorhandenes Vorsorgeguthaben» finde ich den Wert «Guthaben gemäss BVG». Was bedeutet dies?
Das «Vorhandene Vorsorgeguthaben» ist das aktuell angesparte Guthaben. Darin enthalten ist das «Guthaben gemäss BVG». Das BVG-Gesetz bezieht sich auf den oben beschriebenen Lohnbereich zwischen CHF 25'725 und CHF 88'200 mit Sparbeiträgen je nach Alterskategorie von 7 %, 10 %, 15 % und 18 %. Alles in diesem Bereich angesparte Kapital wird unter «Guthaben gemäss BVG» aufgeführt, der Rest gehört zum sogenannten Überobligatorium. Der viel diskutierte gesetzliche Umwandlungssatz von 6.8 % oder der vom Bundesrat festgelegte Mindestzins von aktuell 1 % bezieht sich immer nur auf dieses Guthaben gemäss BVG. Daher sind diese viel diskutieren Werte für eine gutverdienende Ärztin praktisch irrelevant, für einen minimalversicherten Hilfsarbeiter aber absolut zentral.
Weshalb werden die Einkäufe der letzten Jahre auf dem Vorsorgeausweis aufgeführt?
Dies ist wichtig, da diese Einkäufe drei Jahre lang nicht in Kapitalform bezogen werden dürfen, egal ob infolge Pensionierung, Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder Kauf eines Hauses. Wobei es hier zwei Betrachtungsweisen gibt. Aus Sicht der Stiftung dürfen nur die konkreten Einkäufe der letzten drei Jahre nicht ausbezahlt werden. Aus Sicht der Steuerverwaltung darf kein Kapital aus der 2. Säule ausbezahlt werden, weder aus dem aktiven BVG noch aus einer Freizügigkeitsanlage. Findet trotzdem eine Auszahlung statt, wird der Steuerabzug von den betroffenen Einkäufen wieder als Einkommen aufgerechnet und versteuert. Zudem werden Einkäufe und eingebrachte Freizügigkeitsguthaben im Todesfall oftmals anders behandelt als die ordentlichen Sparbeiträge.
Bei den Einkäufen ist praktischerweise auch das Einkaufspotential aufgeführt. Was können Sie uns dazu sagen?
Die Differenz zwischen dem aktuellen Vorsorgeguthaben und dem theoretisch maximalen Guthaben bildet das Einkaufspotential. Die versicherte Person kann also theoretisch verpasste Einzahlungen der Vergangenheit steuerwirksam nachholen. Beim Einkaufspotential «vorzeitige Pensionierung» kann zudem die Differenz des Altersguthaben per ordentlichem Pensionierungszeitpunkt und dem Zeitpunkt der Frühpensionierung, z. B. im Alter 62, vorfinanziert werden.
Dann haben wir noch die Rubrik Risikoleistungen. Wie sind diese zu beurteilen?
Hier sind die Invaliden- und Hinterbliebenenrenten ersichtlich. Die Kinderrenten werden für jedes Kind bis Alter 18 oder wenn es in Ausbildung ist bis maximal Alter 25 ausbezahlt. Die Wartefrist der Invalidenrente beträgt in der Regel 2 Jahre. Bei Invalidität wird zudem auch noch die Prämienbefreiung gewährt.
Bei selbständigen Ärzten sind diese Rentenleistungen aus der zweiten Säule oftmals inkl. Unfalldeckung. Bei angestellten Ärzten ist der Unfall über das UVG gedeckt und daher werden aus der zweiten Säule vor allem Leistungen bei Krankheit erbracht.
Erklären Sie uns die Prämienbefreiung. Das verstehe ich noch nicht ganz.
Wird jemand invalid, dann bezahlt die Stiftung die Prämien längstens bis zum ordentlichen Pensionszeitpunkt. Das ist insofern wichtig, da die oben erwähnten Invalidenrenten nur bis zum ordentlichen Pensionsalter bezahlt werden. Danach kommt die ordentliche Altersleistung zum Tragen. Würde nun eine Ärztin oder ein Arzt invalid, dann hätte diese Person wegen dem unterbrochenen Sparprozess im Alter zu wenig Geld zum Leben. Daher ist es zentral, dass das Sparen weitergeführt wird.
Wissen das die Versicherten?
Die Wenigsten sind sich dieser Thematik bewusst. Wir sitzen oftmals mit Kunden zusammen, welche einen grossen Teil des Altersguthabens mittels Einkäufe aufbauen und dafür die Sparrate nicht auf dem Maximum versichert haben. Wird nun diese Person invalid, dann wird niemand mehr die Einkäufe tätigen und das Altersguthaben wird nicht im gewünschten Umfang anwachsen. Daher empfehlen wir zuerst die Sparrate zu erhöhen und erst danach Einkäufe zu tätigen.
Nun haben wir noch das Thema der Finanzierung. Was gilt es da festzuhalten?
Dieser Teil ist vor allem bei angestellten Ärzten wichtig, da der Arbeitgeber einen Teil der Prämien übernimmt. Im Minimum muss der Arbeitgeber 50 % der Prämie bezahlen. Er kann aber auch einen höheren Beitrag leisten, auf der Gesamtprämie oder z. B. auch nur auf den Risikoprämien.
Ich glaube, wir haben nun alle Punkte angeschaut. Vielen Dank Herr Kaufmann. Noch ein kurzes Schlusswort?
Nehmen Sie sich Zeit für Ihr BVG. Schauen Sie den Vorsorgeausweis an und falls Sie Fragen dazu haben, rufen Sie unsere BVG-Hotline an.
Zur Person
Sergio Kaufmann, Mitglied der Geschäftsleitung
Roth Gygax & Partner AG*
Moosstrasse 2
3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00
mail@fmhinsurance.ch
www.fmhinsurance.ch
*Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Cyberkriminalität, sensible Patientendaten und das neue Datenschutzgesetz
Cybersicherheit wird immer wichtiger. 2023 stehen deshalb weitreichende gesetzliche Änderungen an, etwa das revidierte Datenschutzgesetz.
Die Zahl der Cyberangriffe steigt signifikant, gerade im Gesundheitsbereich mit seinen sensiblen Patientendaten. Hacker haben seit COVID-19 eine grössere Angriffsfläche als je zuvor. MOD1 haben sich auf Informationssicherheit im digitalen Gesundheitssektor spezialisiert.
Die Digitalisierung bestimmt längst auch das Gesundheitswesen. Arztpraxen und Kliniken sind digital vernetzt und Patientenakten in IT-Systemen gespeichert. Das bringt viele Vorteile – weckt aber auch das Interesse von Kriminellen.
Kliniken und Praxen: eine wahre Datenfundgrube für Hacker
Ein Krypto-Trojaner kann sekundenschnell Dateien verschlüsseln: Patientendaten, Diagnosen, Labor- und Operationsberichte. Kriminelle drohen oft mit deren Veröffentlichung, falls ihre Forderung nicht bezahlt wird. Zudem kann ein Ransomware-Angriff zu einem operationellen Unterbruch des Betriebs mit erheblichen Kosten und Reputationsverlust führen.
Die revidierte Gesetzgebung stärkt den Datenschutz
Grundversorgung und Betreuung der Patientinnen und Patienten stehen im Fokus einer medizinischen Einrichtung. Darauf konzentriert sich die Ärzteschaft. Administration und IT werden oft von Mitarbeitenden und externen Firmen übernommen. Während die Praxis bzw. Klinikabläufe fast gleich geblieben sind, schreitet die Digitalisierung rasant voran. Eine Überarbeitung des Datenschutzgesetzes wurde also notwendig. Ab Herbst 2023 ändern sich wichtige Bestimmungen zur Bearbeitung von Personendaten. Das revidierte DSG[1] beschränkt sich wie die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auf den Datenschutz natürlicher Personen. Auch genetische und biometrische Daten gelten neu als besonders schützenswert. Alle Firmen müssen ihren Betrieb durch technische und organisatorische Massnahmen maximal sichern und ihre Richtlinien und Datenschutzerklärungen bis zum Inkrafttreten des neuen DSG am 1. September 2023 angepasst haben. Übergangsbestimmungen sieht das Gesetz nur vereinzelt vor. Kommt es zu Persönlichkeitsrechtsverletzungen, stehen Betroffenen gemäss neuem Gesetz zur Durchsetzung ihrer Ansprüche Rechtsbehelfe zur Verfügung. Als besonders schützenswert gelten alle Gesundheitsdaten. Sie sind streng vertraulich und für Kriminelle oft interessanter als Finanzdaten. Denn Name, Geburtsdatum und AHV-Nummer verlieren ihre Gültigkeit nicht und können auf Jahre hinaus ausgebeutet werden, etwa durch Identitätsdiebstahl[2].
Was sollten medizinische Einrichtungen nun tun?
Wir beraten Gesundheitseinrichtungen und relevante Infrastrukturen zur nachhaltigen und umfassenden Cybersicherheit. Wir empfehlen, eine aktuelle Übersicht über die Organisationsstruktur zu erstellen. Wir helfen, dieses Audit durchzuführen, um Sicherheitslücken zu eruieren und auf Wunsch hin auch zu schliessen. Im Gespräch mit IT-Partnern der medizinischen Einrichtung wird geprüft, ob alle IT-Richtlinien der FMH erfüllt sind. Als Teil dieser Hilfeleistung hat für uns zudem die Sensibilisierung der Mitarbeitenden hohe Bedeutung. Denn nicht selten führen menschliche Fehler zu einer Cyberattacke.
Quellenverzeichnis
[1] Neues Datenschutzgesetz (revDSG) https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/fakten-trends/digitalisierung/datenschutz/neues-datenschutzgesetzrev-dsg.html
[2] Was ist Identitätsdiebstahl? https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich/praevention/digitale-medien/Gefahren/falscheidentitaeten.html
Zur Person
Marielle Johnston, Head of Business Development
MOD1 AG
Aeschenplatz 6
4052 Basel
Telefon 078 927 25 08
marielle.johnston@mod1consulting.com
www.mod1consulting.com
Das ärztliche Rezept: To be or not to be digital
In der Schweiz ist insbesondere im Bereich der telemedizinischen Betreuung von Patientinnen und Patienten das Bedürfnis gewachsen, Rezepte elektronisch an eine Apotheke zu übermitteln.
Seit September 2022 müssen Apotheken in Deutschland ein elektronisches Rezept (E-Rezept) einlösen können. Was in Deutschland noch nicht ganz reibungslos funktioniert, ist in anderen europäischen Ländern schon seit mehreren Jahren etabliert [1],[2]. Immerhin geben im Swiss eHealth Barometer 35% der befragten Arztpraxen an, Rezepte den Apotheken auf elektronischem Wege zukommen zu lassen [3].
Der Bund hat mit der Revision des Heilmittelgesetzes die Minimalanforderungen an ein elektronisches Rezept festgelegt. Damit sollen auch im EPD Rezepte standardisiert abgelegt und abgerufen werden können [3.1]. Dies hat jedoch einen Haken: Gemäss Arzneimittelverordnung müssen Rezepte in Papierform eigenhändig unterschrieben sein. Die elektronische Form bedingt eine qualifizierte Signatur oder eine Übermittlung, welche die Anforderungen an eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt. Weiterhin kann mit der derzeitigen technischen Infrastruktur des EPD keine Logik für die Validierung von Rezepten umgesetzt werden. Somit sind Lösungen zu suchen, mit denen ein Rezept mit einer rechtskonformen Unterschrift versehen und im EPD abgelegt werden kann.
Mit dem E-Rezept versprechen sich Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker Vorteile gegenüber einer Papierlösung. So ist ein häufig erwähntes Argument für das E-Rezepte die verbesserte Lesbarkeit von Rezepten [4]. Ein weiteres Argument ist die Vermeidung von Rezeptmissbrauch. Schliesslich soll mit dem E-Rezept die Adhärenz oder Therapietreue der Patientinnen und Patienten verbessert werden können [5]. Um es gleich vorwegzunehmen: Für viele der genannten Vorteile gibt es heute gut funktionierende Prozesse und Schutzmechanismen. Beispielsweise werden zunehmend Rezepte mit dem Praxissoftwaresystem ausgestellt und ausgedruckt oder mittels sicheren E-Mail versendet und somit wird die Lesbarkeit erhöht. Auch werden in Schweizer Apotheken effektive Massnahmen wie Bezugssperren für Betrüger eingesetzt, um dem Missbrauch vorzubeugen.
Was sind nun die Vorteile eines E-Rezepts für Patientinnen und Patienten wie auch die abgabeberechtigten Gesundheitsfachpersonen?
Steht ausschliesslich die Digitalisierung des Rezepts in Papierform im Vordergrund, kann ein E-Rezept nicht punkten. Der Mehrwert eines E-Rezepts liegt vielmehr in der Weiter- und Wiederverwendung von strukturierten Medikationsdaten, welche die Grundlage für die Unterstützung eines gesamtheitlichen Medikationsprozesses bilden. Die Mehrwerte für Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker sind unter anderem:
- Kontrolle über das Rezept einschliesslich der Rückmeldung bei einer Einlösung,
- Wiederverwendung der einmal erfassten Daten für den Medikationsplan,
- automatische Kontrollen,
- Vorbezug und/oder Übermittlung des verspäteten Rezeptes,
- Vereinfachung von Teilbezügen oder die
- Unterstützung von Abrechnungsprozessen.
Diese können nur dann effizient umgesetzt werden, wenn die Eingabe und Weiterverwendung einschliesslich der Mehrwert-Dienste in die Primärsysteme «nahtlos» integriert sind. Sobald Medikationsdaten händisch zwischen den Primärsystemen und den Mehrwert-Diensten übertragen werden müssen oder gar Medienbrüche entstehen, ist nicht nur die Bearbeitung zeitaufwändig, sondern auch anfällig für Übertragungsfehler.
Warum machen sich die Verbände FMH und pharma-Suisse für E-Rezept stark?
Der Medikationsprozess ist ein wichtiger Anwendungsfalls für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Sowohl innerhalb der Ärzteschaft als auch in der Bevölkerung stossen digitale Anwendungen zur Verbesserung und Unterstützung der korrekten Medikamenteneinnahme auf grosses Interesse [6]. FMH und pharmaSuisse engagieren sich dafür, eine einheitliche und rechtskonforme Lösung in der Schweiz einzusetzen. Diese Lösung muss so ausgestaltet sein, dass sie die Anforderung der Arzneimittelverordnungen hinsichtlich der elektronischen Signatur erfüllt aber auch im EPD genutzt werden kann. Nur ein einheitliches E-Rezept wird nach Auffassung der Verbände von der Bevölkerung wie auch von den abgabeberechtigten Gesundheitsfachpersonen akzeptiert. Mit dem E-Rezept möchten die Verbände die Digitalisierung im Gesundheitswesen in einem wesentlichen Bereich, der Medikation, fördern.
Wie funktioniert das E-Rezept von FMH und pharmaSuisse?
Das E-Rezept von FMH und pharmaSuisse setzt auf den Standard HL7-FIHR und einem Austauschformat, welches mit dem EPD kompatibel ist. Ausgestellt wird das E-Rezept in der Praxissoftware oder einer Webapplikation und mit der persönlichen HIN Identität des Ausstellers signiert. Das Ergebnis ist ein QR-Code, der alle Rezeptdaten sowie die Signatur des Ausstellers enthält. Der QR-Code kann dem Patienten auf Papier ausgedruckt mitgegeben, per Secure-Mail an den Patienten oder die (Versand-) Apotheke gesendet, oder im EPD bereitgestellt werden. Eingelöst wird das E-Rezept in der Apotheke, indem der QR-Code des E-Rezept mit dem bestehenden Barcode-Scanner eingescannt wird. Dabei wird das E- Rezept ausgelesen und die Angaben können in die Apothekensoftware übernommen werden. Anhand der Signatur kann die Apotheke die Gültigkeit des Rezepts jederzeit überprüfen, es validieren, die Verschreibung ausführen und das Rezept vollständig oder zum Teil entwerten. Hierzu erhält jedes ausgestellte E-Rezept eine nicht auf den Patienten rückführbare eindeutige Identifikationsnummer, die zusammen mit Transaktionsdaten zentral gespeichert werden. In keinem Fall werden personenbezogene Daten zentral gespeichert.
Wann ist das E-Rezept in der Schweiz verfügbar?
Das E-Rezept der Verbände ist bereits heute technisch einsetzbar. Damit es schweizweit genutzt werden kann, muss es in allen Apotheken in der Schweiz eingelöst werden können. Nur so ist die Wahlfreiheit für Patientinnen und Patienten gegeben, die im Heilmittelgesetz verankert ist. Aktuell finden in verschiedenen Regionen Pilotprojekte statt, in denen die Verbandslösung erprobt und stetig weiterentwickelt sowie verbessert wird. Die Pilot-Verbandslösung nutzt die Signaturenlösung HIN Sign und die Medikationssoftware Documedis und setzt auf den Standard CHMED16A, der durch den Verein IG eMediplan gepflegt wird [7]. Die Verfügbarkeit und die Benutzerfreundlichkeit sind Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche und flächendeckende Einführung des E-Rezepts. Designprobleme können nicht nur neue Arten von Fehlern erzeugen sondern auch zum Abbruch der Nutzung des E-Rezepts führen [8]. Parallel dazu müssen die Anliegen und Bedürfnisse alle am Medikationsprozess direkt oder indirekt beteiligten Organisationen und Verbände abgeholt werden. Dies benötigt Zeit.
Quellenverzeichnis
[1] L. Patrao, R. Deveza, and H. Martins, “PEM-A New Patient Centred Electronic Prescription Platform,” Procedia Technol., vol. 9, pp. 1313–1319, 2013, doi: https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.147
[2] M. Sääskilahti, A. Ojanen, R. Ahonen, and J. Timonen, “Benefits, Problems, and Potential Improvements in a Nationwide Patient Portal: Cross-sectional Survey of Pharmacy Customers’ Experiences.,” J. Med. Internet Res., vol. 23, no. 11, p. e31483, Nov. 2021, doi: 10.2196/31483
[3] L. Golder, “Swiss eHealth Barometer 2021,” 2021. [Online]. Available: https://www.gfsbern.ch/wp-content/uploads/2021/06/213111_ehealth_schlussbericht_gesundheitsfachpersonen-und-akteure-des-gesundheitswesens.pdf
[3.1] Siehe Faktenblatt eMedikation von eHealth Suisse (https://www.e-healthsuisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/D/factsheet-emedikation.pdf)
[4] T. A. Meyer, “Improving the quality of the order-writing process for inpatient orders and outpatient prescriptions.,” Am. J. Heal. Pharm. AJHP Off. J. Am. Soc. Heal. Pharm., vol. 57 Suppl 4, pp. S18-22, Dec. 2000, doi: 10.1093/ajhp/57.suppl_4.S18
[5] D. Aluga, L. A. Nnyanzi, N. King, E. A. Okolie, and P. Raby, “Effect of Electronic Prescribing Compared to Paper-Based (Handwritten) Prescribing on Primary Medication Adherence in an Outpatient Setting: A Systematic Review.,” Appl. Clin. Inform., vol. 12, no. 4, pp. 845–855, Aug. 2021, doi:10.1055/s-0041-1735182
[6] V. Pfeiffer and R. Sojer, “«There is an App for That»: Zukunft oder a¨rztlicher Alltag?,” Schweizer Ärztezeitung, vol. 103, no. 31–32, pp. 962–965, 2022
[7] eHealth Suisse, “eMedication in the context of the Electronic Patient Record,” 2020. Accessed: Oct. 12, 2022. [Online]. Available: https://www.ehealth-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/E/report-emedicationarchitecture-epr.pdf
[8] A. Porterfield, K. Engelbert, and A. Coustasse, “Electronic prescribing: improving the efficiency and accuracy of prescribing in the ambulatory care setting.,” Perspect. Heal. Inf. Manag., vol. 11, no. Spring, p. 1g, 2014
Zur Person
Reinhold Sojer, Leiter Abteilung Digitalisierung/eHealth der FMH
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH
Elfenstrasse 18
3006 Bern
Telefon 031 359 11 11
info@fmh.ch
www.fmh.ch
Selbstständigkeit
Für viele Ärztinnen und Ärzte stellt sich im Verlaufe ihrer Tätigkeit die Frage, ob sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen sollen.
Dieser Schritt weist vielschichtige Aspekte auf, welche einerseits von den Erfahrungen und andererseits von der individuellen Zeitachse der Ärztin oder des Arztes geprägt werden. Wir haben dieses Thema mit Herrn Gregor Dietrich, Consultant der FMH Services, diskutiert.
Herr Dietrich, welches sind nach Ihren Erfahrungen die massgebenden Aspekte für den Entscheid in die Selbstständigkeit?
Selbst entscheiden, was man macht! Das fasst es wohl gesamthaft zusammen. Damit meine ich, dass eine Ärztin oder ein Arzt keine Anweisungen eines Vorgesetzten befolgen muss, wie die Patientinnen und Patienten behandelt werden müssen. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Freiheiten. Sie/Er kann ihre/seine Arbeit selbst planen und einteilen. Dies ist auch ein wichtiger Aspekt bezüglich der Familienplanung.
Auf welche Themen gilt es beim Schritt in die Selbstständigkeit besonders zu achten?
Der Weg in die Selbstständigkeit sollte sorgfältig geplant und umgesetzt werden. Wichtig scheint mir insbesondere die Berücksichtigung von zeitlichen Aspekten und Verpflichtungen.
Können Sie Vorteile der Selbstständigkeit nennen?
Das sind meines Erachtens vor allem die Aspekte des Gestaltungsfreiraums:
- Flexible Planung und Umsetzung des Pensums sowie der Arbeitszeit
- Rekrutierung und Zusammenstellung einer eigenen Crew
- Delegation von Aufgaben und Verantwortungen
- Auslagerung von Administration und Fokussierung auf medizinische Aufgaben
- Individuelle Patientenbetreuung
- Prozesssteuerung / Ideen ausprobieren und ggf. wieder verwerfen
- Selbstbestimmung über eigenen Lohn und auch über Kosten
- Aufbau eines langfristigen Vertrauensverhältnisses
Können Sie etwas zu den Verdienstmöglichkeiten sagen?
Generell würde ich sagen, dass eine Ärztin oder ein Arzt bei etwa gleicher Arbeitsbelastung mehr verdient.
Wo können Knackpunkte bei der eigenen Praxis liegen?
Es ist nicht einfach, gute Angestellte zu finden, welche auch die Betriebsphilosophie mittragen. Auch die Anzahl der Mitarbeitenden muss laufend hinterfragt werden. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, über eine gewisse Flexibilität zu verfügen. Für eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit erachte ich das Betriebsklima als entscheidend. Anforderungen, Abgabe von Aufgaben und Honorierung sollten im Einklang stehen, den Fähigkeiten der Person gerecht werden, und es muss von Wertschätzung getragen werden.
Im Grundsatz möchte ich festhalten, dass die Ärztin oder der Arzt in der Praxis gerne arbeiten sollte und sie/er auch Planungs- und Organisationsaufgaben als Chefin oder Chef steuern will und kann.
Ein Pensum von 50 Prozent oder weniger als Ärztin oder Arzt in Selbstständigkeit (in Einzelpraxis) erachte ich aus wirtschaftlicher Sicht nicht als sinnvoll, da diverse Fixkosten sowieso vorhanden sind.
Was würden Sie einer Ärztin oder einem Arzt empfehlen, die/der sich mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandersetzt?
Im Vorfeld gilt es einerseits, den Zeitpunkt und die persönlichen Rahmenbedingungen, sowie andererseits, die finanziellen Möglichkeiten zu prüfen.
Als Grundlage können Informationen in Gesprächen mit Kollegen oder über einen Besuch eines Seminars der FMH Services eingeholt werden.
Ich bin überzeugt, dass eine Unterstützung durch eine erfahrene Fachperson beim Weg in die Selbstständigkeit Sicherheit und Entlastung bringt. Es gilt hier das Fachwissen für betriebswirtschaftliche und juristische Aspekte wie die Rechtsform zu berücksichtigen, auf Erfahrungen betreffend Raumdimensionen und Einrichtungen zurückzugreifen sowie Versicherungsund Treuhandspezialisten einzubeziehen.
Wie beurteilen Sie das Thema der Unternehmensform?
Aus meiner Sicht empfehle ich, dies frühzeitig anzuschauen und durch eine Fachperson aufgleisen zu lassen. Schlussendlich ist es aber eine persönliche Entscheidung, welche vor allem die eigenen Rahmenbedingungen und Einstellungen berücksichtigen sollte. Dafür empfehle ich, sich von versierten Fachleuten wie Juristen, Treuhändern (Steuerberatern) und Vorsorgespezialisten unterstützen zu lassen. Alle drei Fachpersonen sind bei dieser persönlichen Entscheidung wichtig, und man sollte nicht nur auf Kollegen hören.
Kennen Sie Fälle, wo eine Ärztin oder ein Arzt den Schritt in die Selbstständigkeit bereut hat?
Nein, solche Fälle dürften meines Erachtens äusserst selten sein. Wenn diese Entscheidung auf sachlichen Grundlagen getroffen und nach Möglichkeit von versierten Fachleuten begleitet wird, stellt die Entscheidung zugunsten der Selbstständigkeit in der Regel einen konsequenten Karriereschritt dar.
Der Goodwill – ein umstrittener Begriff in einer neutralen Betrachtung
Der Goodwill ist für manche ein Mysterium, denn er ist nicht greifbar und es kursieren viele Gerüchte und Unwahrheiten. Wir klären auf.
Viele fragen sich, was der Goodwill überhaupt ist. Darf ich einen solchen verlangen? Und wenn ja, wie ist er zu berechnen? Um es vorwegzunehmen, der Goodwill ist der sogenannte immaterielle Wert der Praxis, und einen solchen zu verlangen, ist weder verboten noch unüblich, im Gegenteil.
Darf ich einen Goodwill verlangen?
Viele Ärzte/-innen hinterfragen oft den Goodwill einer Arztpraxis, sei es als Verkäufer/in wie aber auch als Käufer/in einer Praxis resp. eines Praxisanteils. Es ist ein schwieriges Thema, denn der Goodwill ist im Gegensatz zum Inventar nicht greifbar. Einige kantonale Ärztegesellschaften und grössere Spitäler empfehlen der Ärzteschaft, das Thema Goodwill schon gar nicht zu thematisieren. Sie verbieten allerdings die Goodwillforderungen und -zahlungen nicht, was nicht nur betriebswirtschaftlich korrekt ist, es wird auch vonseiten FMH Services wie auch FMH als gerechtfertigt angesehen (siehe Empfehlungen Delegiertenversammlung der FMH vom 31. Januar 2008 und «Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag», S. 182 ff.).
Was ist der Goodwill?
Beim Goodwill handelt sich um einen fiktiven Wert, den man nicht in die Hand nehmen kann. Umso mehr ist eine Aufklärung über den Goodwill und den Sinn dieses Wertes enorm wichtig. Doch was ist ein Goodwill?
Übersetzt man den Begriff wortwörtlich ins Deutsche, entsteht bereits eine gute Erklärung: «Guter Wille». Damit kann gesagt werden: Der Goodwill ist ein fiktiver Wert. Diesen gibt es nicht nur bei Arztpraxen, nein, alle Unternehmen wie z. B. ein Restaurant, eine Bäckerei, ein Architekturbüro, ein professioneller Sportklub sind davon betroffen oder auch kleinere Betriebe bis zu Unternehmen wie Coca-Cola. Laut betriebswirtschaftlicher Lehre wird der Goodwill wie folgt definiert: «Der Goodwill ist eine Grösse, welche die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Substanzwert (Inventar usw.) eines Unternehmens erklärt. Er beinhaltet sämtliche immateriellen Werte einer Firma, die buchhalterisch nicht erfasst werden können.» Wir sagen, er widerspiegelt den Organisationswert einer Unternehmung und beinhaltet viele «weiche Faktoren» einer Firma. Übernimmt ein/e Nachfolger/in oder ein/e Partner/in ein Unternehmen oder Anteile davon, so kauft er/sie nicht nur das Inventar ab, er/sie übernimmt auch das Personal, Telefonnummern, allenfalls eine neutrale Webseite, Lieferantenverträge, den Standort mit all seinen Vor- und Nachteilen, und zu guter Letzt übernimmt er/sie auch die Patientinnen und Patienten. Das Unternehmen ist organisiert, jeder Angestellte weiss, was zu tun ist, und der Betrieb funktioniert. Die Patienten/-innen sind es gewohnt bei gesundheitlichen Problemen in die ihnen bekannte Praxis zu gehen oder auf die bekannte Telefonnummer anzurufen. Je nach Fachrichtung haben Praxisinhaber/innen oft auch ein grosses Netzwerk an zuweisenden Ärzten. Dieses Netzwerk wird ebenfalls übertragen, und der/die Nachfolger/in oder der/die Partner/in profitieren davon.
Die/der Verkäufer/in hat so ein gut funktionierendes Unternehmen erschaffen und gepflegt. Der/die Nachfolger/in kann in die Fussstapfen treten und dort weitermachen, wo der/die Vorgänger/in aufgehört hat, vom ersten Tag an. Der/die Käufer/in muss also keine oder nur wenig Zeit (meist die Freizeit und Arbeitszeit) investieren, um sein/ihr Unternehmen zu erschaffen. Ihm/Ihr bleiben viele zeitintensive Aufgaben wie einen Standort suchen, Personal rekrutieren, mit dem Architekten die Pläne ausarbeiten, Material und Möbel auswählen, die Baustelle überwachen und die Evaluation von weiteren Geschäftspartnern wie den Telecomanbieter, EDV-Support, Laborpartner erspart. Wer einmal selbst ein Haus gebaut hat oder jemanden kennt, der eines gebaut hat, weiss, was auf einen zukommt.
Mit dem Goodwill gilt es auch, dem/der Verkäufer/in Respekt zu zollen dafür, dass er/sie das Unternehmen aufgebaut und so geführt hat, dass man heute eine gesunde Firma übernehmen und weiterführen kann. Das alles hat einen Wert: den Goodwill.
Berechnung des Goodwills
Es gibt viele Methoden zur Bestimmung des Goodwills. FMH Services hat bezüglich der Bewertung von Arztpraxen viel Erfahrung und wendet dazu ein selbst entwickeltes Verfahren an, welches sich bei Banken und in der Ärzteschaft seit Jahrzehnten bewährt hat sowie von den Gerichten in Scheidungsfällen anerkannt wird. Das Verfahren grob erklärt: Die Grundlage für den Wert des Goodwills bildet der durchschnittliche Jahresumsatz der vergangenen 3–5 Jahre einer Arztpraxis. 1/5 dieses Durchschnitts ergibt den Basiswert für den Goodwill. Um den definitiven Goodwill zu berechnen, werden die Praxis und ihre Umgebung einer Analyse unterzogen. Anhand dieser Analyse wird auf den Basiswert ein Auf- oder Abschlag berechnet. Ein Gespräch mit der/dem Praxisinhaber/in ist ein wichtiger Eckpunkt dieser Bewertung.
Weitere Aspekte des Goodwills
Wir bei FMH Services sind täglich mit dem Thema Goodwill konfrontiert – sei es bei unseren Bewertungen, aber auch bei Praxisübergaben. Die Banken sind nicht skeptisch gegenüber dem Goodwill, wenn ein/e Nachfolger/in einen Investitionskredit für die Praxisübernahme beantragt. Sie sehen dieses Thema als normal an und gewähren einen Kredit, um die Praxis zu kaufen und um allfällige Neuinvestitionen zu tätigen. Eine Praxisbewertung bzw. Praxisdokumentation, welche die Praxis mit all ihren Facetten beschreibt, ist oft von Vorteil bei den Verhandlungen mit den Banken. Mit dieser Bewertung sieht die Bank genau, was der/die Nachfolger/in übernimmt und welches Potenzial die Praxis hat.
Ein zusätzlicher Nutzen ist auch, dass die/der Nachfolger/in den bezahlten Goodwill in seiner/ihrer Bilanz aktivieren kann und über mehrere Jahre abschreiben darf. So verringert sie/er buchhalterisch seinen/ihren Gewinn und kann legal Steuern und Sozialabgaben einsparen.
FMH Services empfiehlt sowohl der/dem Verkäufer/in wie auch der/dem Käufer/in, sich mit dem Thema Goodwill auseinanderzusetzen, es gemeinsam zu besprechen und sich in einer Verhandlung auf einen Preis zu einigen.
Die Arztpraxis als AG – Entscheidungsgrundlagen
Es bedingt eine sorgfältige Analyse der Situation und eine ebenso sorgfältige Planung mit Einbezug der Vorsorgeplanung bei einem versierten Berater, der die Branche kennt.
Ärzte, die erwägen, die Organisationsform ihrer Arztpraxis zu ändern – von einer Einzelfirma oder einfachen Gesellschaft zu einer Aktiengesellschaft (AG) oder in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – nennen dafür hauptsächlich drei Gründe: An erster Stelle steht die Steuerersparnis, gleich darauf folgt die Haftungsfrage, danach die Begründung, dass mit einer AG oder GmbH die Nachfolgeregelung einfacher werde. Betrachten wir demnach diese Gründe etwas genauer.
1. Die Steuerersparnis
Als Erstes sollten die Systemunterschiede der Steuern betrachtet werden.
Einzelpraxis oder auch Gesellschafter einer Praxisgemeinschaft
Der Arzt versteuert sein Einkommen aus ärztlicher Tätigkeit am Ort der Erbringung, also am Standort der Praxis. Ebenso versteuert er das Geschäftskapital (Vermögenssteuer) am Standort der Praxis. Weitere Nebeneinkommen wie z. B. Vermögenserträge, Eigenmietwert etc. unterliegen am Wohnort der Einkommenssteuer, private Vermögenswerte wie z. B. ein Wertschriftenportefeuille und selbstbewohnte Immobilien unterliegen der Vermögenssteuer am Wohnort. Wenn Wohnort und Praxis nicht in der gleichen Gemeinde liegen oder sogar in anderen Kantonen, gibt es eine interkommunale bzw. eine interkantonale Steuerausscheidung.
AG oder GmbH
Der Arzt erwirtschaftet einen Lohn, er ist Angestellter, somit deklariert er seinen Lohn am Wohnort. Seine Praxis AG/GmbH erwirtschaftet einen Gewinn, dieser wird am Standort der Praxis (Sitz) versteuert. Der Gewinn der AG/GmbH kann/soll als Dividende ausgeschüttet werden und wird zu einem reduzierten Satz als Einkommenssteuer am Wohnort des Arztes versteuert (mind. Beteiligung 10 %). Die Beteiligung an der AG wird zum Ertragswert bewertet und als Vermögen am Wohnort versteuert (die Aktien oder Beteiligungen sind Wertschriften). Dies kann bei ständiger Erwirtschaftung von Gewinn in der AG/GmbH ein Mehrfaches des Nominalwertes (Gründungswert der Aktie) sein.
Vergleichsberechnung
Nehmen wir den Kanton Aargau, steuerlich im Mittelfeld, für einen Vergleich.
Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit: CHF 300’000
zu versteuern Tarif B, Gemeinde Aarau: Kanton und Gemeinde CHF 50’400, Bund CHF 25’600
Total Steueraufkommen als Selbstständigerwerbender: CHF 76’000
Einkommen als Angestellter der eigenen AG: CHF 200’000
Dividendenausschüttung: CHF 85’000 (Dividenden Teileinkunft Kanton 50 %, Bund 70 %)
zu versteuern Tarif B, Gemeinde Aarau: Kanton und Gemeinde CHF 38’400, Bund CHF 20’300
Total CHF 58’700
Gewinn der AG/GmbH: CHF 100’000
Steuern Kanton Aarau CHF 7’900, Bund CHF 7’200
Total CHF 15’100
CHF 58’700 und CHF 15’100 ergeben ein totales Steueraufkommen als Inhaber der Praxis AG von CHF 73’800. Also in diesem Fall nicht wirklich eine Steuerersparnis. Nicht berücksichtigt ist die Vermögenssteuer, die je nach Gewinn der AG und der nachfolgenden Ertragswertermittlung der Steuerverwaltung den steuerlichen Vermögenswert der AG um ein Mehrfaches ansteigen lässt.
Ausgelassen haben wir zudem die Verrechnungssteuer von 35 %, eine allfällige Kapitalsteuer der AG und das aufnehmen der gesetzlichen Reserve.
Der einzige wirkliche Spareffekt liegt bei der AHV; da rund CHF 100’000 weniger als Erwerbseinkommen deklariert werden, spart der Arzt rund CHF 10’000 an AHV-Prämien.
Dem gegenüber steht erhöhter treuhänderischer Aufwand, es braucht einen Geschäftsbericht, eine zusätzlicheSteuererklärung für die AG und eine sorgfältige Abwicklung der Deklaration zur Verrechnungssteuer. Die Verrechnungssteuer kann überdies nicht bezogen werden, sondern wird mit zeitlichem Verzug den Steuern im Folgejahr angerechnet.
Auch die Umstrukturierung selbst von der Einzelfirma zur juristischen Person braucht einen enormen administrativen Aufwand, von der ZSR-Nummer bis zum Telefonabonnement muss alles geändert werden.
Oft werden Einkäufe in die Pensionskasse sowie ein hoher Sparlohn als versichertes Einkommen bei der Pensionskasse der Selbstständigerwerbenden genutzt, um die durch das Studium verpassten Vorsorgebeiträge in die Pensionskasse nachzuholen. Als Lohnempfänger der eigenen AG wird diese Möglichkeit stark reduziert.
Einkäufe von Beitragsjahren in die Pensionskasse bei Selbstständigerwerbenden werden zu 50 % von den AHV-Beiträgen befreit, bei Lohnempfängern gilt diese Regel nicht.
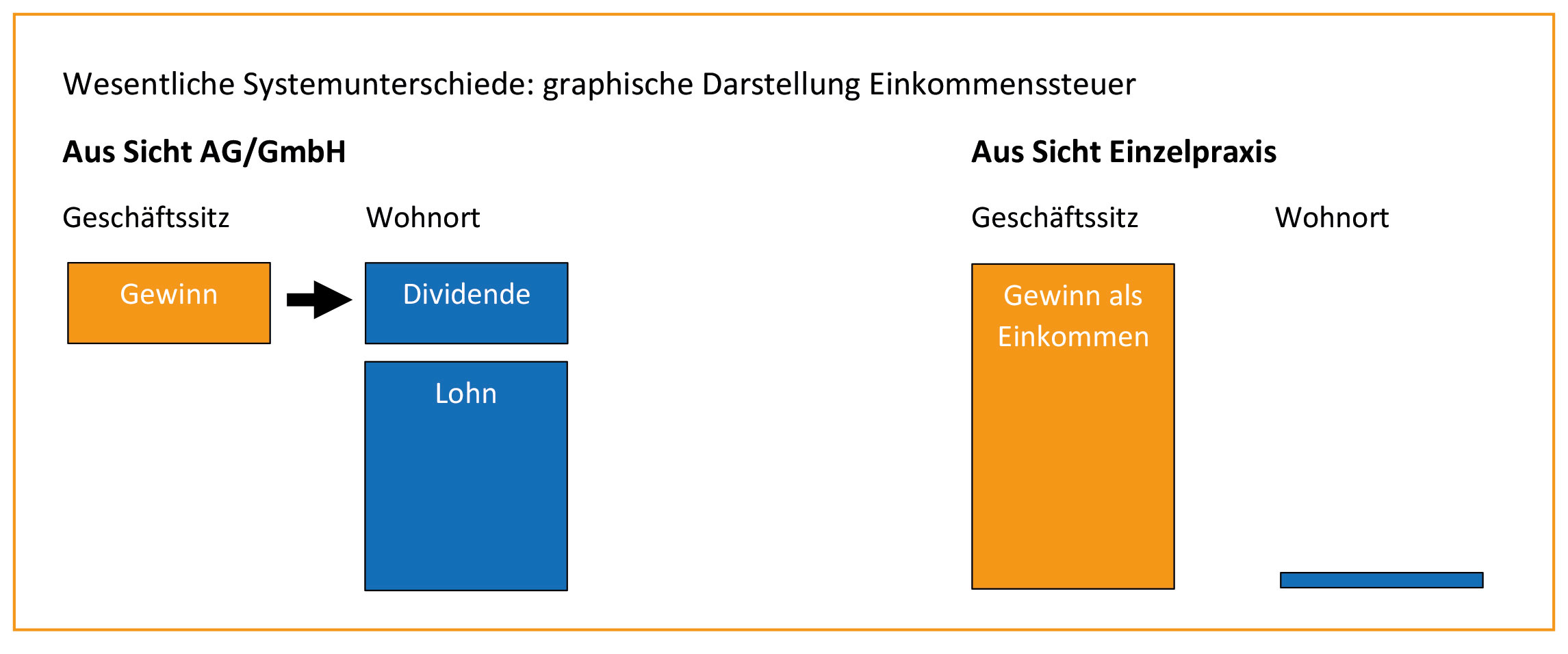
Praxis AG mit zwei oder mehr Ärzten
In unserem Beispiel beschliessen zwei Berufskollegen, eine Praxis AG zu gründen, beide je zu 50 %. Ebenfalls beschliessen sie einen Grundlohn von 2/3 und als Dividendenausschüttung 1/3 des zu erwartenden Gewinns von CHF 600’000. Beide arbeiten das gleiche Pensum, der eine, Aktionär A, erwirtschaftet CHF 350’000, der andere, Aktionär B, CHF 250’000. Nun zahlen sie sich einen Lohn von je CHF 200’000 aus, der Rest wird als Gewinn in Form einer Dividende ausgeschüttet. Da beide je 50 % halten, wird auch der Gewinn symmetrisch verteilt, je CHF 100’000. Aktionär A wird hiermit nicht zufrieden sein, denn er hat gegenüber Aktionär B CHF 100’000 mehr erwirtschaftet, erhält jedoch nur CHF 50’000, die anderen CHF 50’000 schenkt er Aktionär B, weil dieser von Gesetzes wegen am Gewinn zu 50 % beteiligt ist.
Gegenüber den meisten KMU produzieren/erwirtschaften die Ärzte durch ihre Tätigkeit den Umsatz selber, deshalb wird eine gerechte und genaue Aufteilung des Gewinns nur in seltenen Fällen erreicht. Bei einer klassischen Praxisgemeinschaft (einfache Gesellschaft) erhält jeder Gesellschafter den Ertrag, den er auch selber erwirtschaftet und verantwortet.
Wo eine AG oder GmbH Sinn macht
Nun stellt sich berechtigterweise die Frage, wo bzw. in welcher Konstellation denn eine AG oder GmbH Sinn macht. Über alle Kantone und deren steuerliche Unterschiede betrachtet, gibt es kein Patentrezept. Je nach persönlicher Situation und Gewinn der Praxis kann eine Umstrukturierung bereits ab einem Gewinn von CHF 300’000 attraktiv sein, anderseits kann bei anderer persönlicher Situation und anderem Kanton eine Umstrukturierung erst ab CHF 600’000 Sinn machen. In jedem Fall sollte eine individuelle Berechnung unter Einbezug der bestehenden Pensionskassenlösung und des jeweiligen Kantons, in welchem sich der Standort der Praxis befindet, durchgeführt werden.
Eher Sinn macht eine Umstrukturierung von der Einzelpraxis in eine AG oder GmbH, wenn sich der Wohnort in einem steuergünstigen Kanton und die Praxis in einem steuerdurchschnittlichen Kanton befindet, klassisches Beispiel: Praxis im Kanton Zürich, Wohnort im Kanton Schwyz. Aber auch hier gilt, erst mit allen Konsequenzen und langfristiger Betrachtung, durch einen fachlich versierten Berater berechnen zu lassen.
Wachstum und Expansion
Vermehrt können wir beobachten, dass sich Gruppenpraxen mit mehreren Leistungsanbietern bilden, um den Patienten die medizinischen Leistungen möglichst aus einer Hand anbieten zu können. Sofern diese ambulanten Zentren von einigen Ärzten gegründet werden und diese dann weitere Ärzte und Therapeuten als Leistungserbringeranstellen, wird die Möglichkeit einer ungerechten Aufteilung des Gewinns entschärft. Da nicht jeder Leistungserbringer Aktionär und Mitinhaber ist, wird sein erwirtschafteter Gewinn unter den Aktionären gemäss ihrem jeweiligen Anteil verteilt, es erfolgt ein Ausgleich der individuellen Gewinnerwirtschaftung.
2. Die Haftungsfrage
Eine juristische Person haftet nur mit dem Gesellschaftsvermögen, das ist richtig. Aber welches sind denn die wirklichen Risiken? Nur selten fällt eine Arztpraxis in Konkurs, es ist die Branche mit dem kleinsten Konkursrisiko. Aber das wirkliche Risiko liegt bei einem Kunstfehler, weshalb die Ärzte eine «Berufshaftpflicht» abschliessen müssen, damit sie überhaupt die kantonale Zulassung bekommen. Die Berufshaftpflicht ist immer personenbezogen, egal, ob ein Arzt angestellt in eigener AG/GmbH oder als selbstständig-erwerbender Arzt tätig ist.
3. Die Nachfolgeregelung
Ob nun ein nachfolgender Arzt eine bestehende AG bevorzugt oder auch nicht, ist in den meisten Fällen nicht auf betriebswirtschaftlicher Motivation begründet.
Es ist mehr beim nachfolgesuchenden Arzt die Idee, dass eine Praxis AG attraktiver und moderner scheint. Und anderseits auch die Steuerersparnis beim Verkauf, namentlich der «steuerfreie Kapitalgewinn».
Der steuerfreie Kapitalgewinn ist der Wert bei einem Verkauf von Aktienanteilen, der den Buchwert (Aktiven in der Bilanz) übersteigt; z. B. ein Ultraschallgerät, das auf dem Markt noch einen realen und realisierbaren Verkaufswert von einige Tausend Franken wert hat, aber in der Buchhaltung zum Wert Null geführt wird, weil vollständig abgeschrieben. Oder der Goodwill (immaterieller Wert), der sich unter anderem aus dem bestehenden Patientengut ergibt.
Wenn wir also davon ausgehen, dass die AG ein Stammkapital von CHF 100‘000 aufweist, dass auf null abgeschriebene Werte noch ein realer Wert von CHF 10‘000 und ein Goodwill von CHF 10‘000 bestehen, dann reden wir hier von einem Kaufpreis der Aktien von CHF 120‘000. Diese CHF 20‘000 bedeuten den «steuerfreien Kapitalgewinn».
Nun könnte die Idee entstehen, Gewinne über die Jahre hinweg nicht als Dividenden zur Auszahlung zu bringen und bei Verkauf als steuerfeien Kapitalgewinn zu beziehen, das wäre dann eine Steuerumgehung und kommt schmerzhaft teuer zu stehen. Es gibt da einige interessante Ideen und Konstellationen, die jedoch auch die Steuerverwaltung alle ausnahmslos sehr gut kennt. Auch zu beachten ist die Sperrfrist bei Verkauf von Aktien. Um einen steuerfreien Kapitalgewinn realisieren zu können, müssen die Aktien mindestens fünf Jahre gehalten werden.
Die Nachfolgeregelung bei der Einzelfirma nennt sich schlicht und einfach Liquidation, ob sie nun verkauft oder geschlossen wird. Im Unterschied zum steuerfreien Kapitalgewinn gewährt hier der Gesetzgeber die sogenannte «privilegierte Liquidationssteuer».
Einziger Wermutstropfen ist hier die AHV, die auf den ganzen «privilegierten Liquidationsbetrag» ihren Beitrag erhebt.
Zur Person
Jean-Pierre Ceccon ist Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Financial Planner CFP©, Dipl. Steuerberater NDS HR
Ceccon Consulting & Partner AG*
Baselstrasse 10
4222 Zwingen
Telefon 061 261 08 08
mail@fmhtreuhand.ch
www.fmhtreuhand.ch
*Ceccon Consulting & Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Praxiseröffnung leicht gemacht
Viele Ärztinnen und Ärzte verfolgen den Traum einer eigenen Praxis. Dabei stellen sich zahlreiche Hürden und Hindernisse.
Seit über 20 Jahren begleiten wir die Ärzteschaft bei Fragen zu Versicherungen und Vorsorge. Was es bei einer Praxisübernahme oder Praxisgründung zu beachten gilt, fassen wir in diesem Beitrag zusammen.
1. BerufshaftpflichtversicherungEine Berufshaftpflichtversicherung ist häufig die erste Deckung, welche angehende Praxisinhaber/innen benötigen. Die meisten Kantone verlangen im Bewilligungsverfahren einen entsprechenden Deckungsnachweis. Deshalb wird eine Haftpflichtversicherung oft schon Monate vor dem Praxisstart benötigt. Mit unseren spezialisierten Versicherern können wir Ihnen in der Regel innerhalb von 24-48 Stunden den Nachweis organisieren, damit das Bewilligungsverfahren fortgesetzt werden kann.
2. Praxis-Versicherungen
In die neue Praxis fliesst häufig viel Geld. Es müssen beispielsweise teure medizinaltechnische Geräte angeschafft werden oder die Praxis wird umgebaut, um bald Patienten optimal begrüssen zu können. Diese Investitionen gilt es umfassend zu versichern.
2.1 Praxis-Sachversicherung
Eine Praxis-Sachversicherung schützt Ihr Inventar und Ihre Geräte gegen Beschädigung, Abhandenkommen und Zerstörung. Wir empfehlen hier in der Regel eine moderne All-Risk Lösung, wodurch bis auf wenige Ausnahmen alle Risiken mitversichert sind. Selbst Schäden infolge Erdbeben oder sogenannte innere Schäden (z. B. Überspannung) sind versicherbar.
Weiter deckt diese Versicherung auch die Umsatzeinbussen und Mehrkosten nach einem versicherten Ereignis. Können Sie beispielsweise nach einer Überschwemmung die Praxis temporär nicht mehr öffnen und müssen andere Räumlichkeiten mieten, sind diese Kosten versichert.
2.2 Rechtsschutz
Vielleicht verfügen Sie bereits über eine Privat- und Verkehrsrechtsschutzdeckung. Praxisinhaber/innen benötigen zusätzlich eine Betriebs- und Berufsrechtsschutzdeckung, damit sich die Versicherung auch auf die Praxis erstreckt. Besonders wichtig ist eine Deckung bei Streitigkeiten bezüglich unwirtschaftlicher Leistungserbringung mit der Santé Suisse, welche in unseren spezialisierten Rahmenvertragsprodukten enthalten ist.
2.3 Cyberversicherung
Arztpraxen verfügen über hochsensible Daten und rücken immer mehr in den Fokus von Hackern. Eine Cyberversicherung deckt einerseits die eigenen Kosten nach einem Cyberereignis wie zum Beispiel die Datenwiederherstellung oder die Beseitigung von Schadprogrammen. Andererseits umfasst sie auch eine Haftpflichtdeckung, welche für Schadenersatzansprüche oder bei Ansprüchen aufgrund von Datenschutzverletzungen aufkommt.
3. Personalversicherungen
In Ihrer neuen Rolle als Arbeitgeber benötigen Sie verschiedene – oft obligatorische – Deckungen für Ihr Praxispersonal.
3.1 Unfallversicherung UVG
Alle Arbeitnehmenden in der Schweiz müssen obligatorisch unfallversichert sein. Deshalb benötigen Sie sowohl für Ihre MPAs wie auch für eine Reinigungskraft eine UVG-Lösung. Hierbei handelt es sich um eine Pauschalversicherung. Das heisst, nicht jeder Mitarbeiter muss einzeln versichert werden, sondern die gesamte Jahreslohnsumme.
3.2 Krankentaggeld KTG
Eine Krankentaggeldversicherung deckt den kurzfristigen Lohnausfall eines Mitarbeitenden infolge Krankheit. Zwar besteht gemäss Obligationenrecht eine Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers, die Versicherung hingegen ist freiwillig. Wir empfehlen den Abschluss unbedingt, einerseits damit sich der Arbeitgeber schadlos halten kann, da er im Krankheitsfall den Lohn weiter entrichten muss. Andererseits gilt es die Mitarbeitenden umfassend abzudecken. Während die gesetzliche Lohnfortzahlungspflicht je nach Dienstalter nur wenige Wochen umfasst, bezahlt die KTG-Versicherung den Lohnausfall in den ersten 2 Jahren der Krankheit.
3.3 Berufliche Vorsorge BVG
Alle Arbeitnehmenden, die über CHF 21‘510 verdienen, müssen in einer Pensionskasse versichert werden. Das Gesetz gibt dabei minimale Anforderungen an den Vorsorgeplan vor, welche wahlweise verbessert werden können. Wir empfehlen zumindest bei den Risikodeckungen ein Leistungsprimat, also eine Abdeckung eines Prozentbetrages des Lohnes.
4. Persönliche Vorsorge
Was leider häufig in der Prioritätenliste nicht zuoberst steht, aber äusserst wichtig ist, ist die persönliche Vorsorge. Viele Neugründer waren vorher in einer Anstellung, in welcher Sie gegen Erwerbsunfähigkeit und Todesfall automatisch versichert waren. Zwar bleibt die 1. Säule (AHV/IV) auch in der Selbständigkeit erhalten, ein Grossteil des bisherigen Versicherungsumfangs fällt jedoch weg und muss neu selbst organisiert werden.
4.1 Taggeld
Der kurzfristige Lohnausfall infolge Krankheit oder Unfall des Inhabers resp. der Inhaberin kann mit einer Taggeld-
versicherung abgedeckt werden. Denken Sie daran, möglichst nicht nur Ihren persönlichen Bedarf, sondern auch laufende Praxiskosten zu versichern, welche bei einem Ausfall weiterlaufen würden bis beispielsweise eine Stellvertretung die Praxis weiterführen könnte.
4.2 Einzelunfallversicherung
Speziell für die Bedürfnisse der Ärzteschaft haben wir eine Einzelunfallversicherung entwickelt. Diese versichert eine Kapitalleistung von 1 Mio. gemäss einer speziellen Gliederskala. Die Idee dahinter ist, dass beispielsweise ein Herzchirurg bei Verlust eines Daumens seiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen kann, ohne gemäss Sozialversicherungen als invalid zu gelten.
4.3 Berufliche Vorsorge BVG
Invaliden- und Hinterlassenenleistungen können in der beruflichen Vorsorge BVG versichert werden. Zudem können Sie so den Prozess des Alterssparen optimal weiterführen und ebenfalls gegen Erwerbsunfähigkeit absichern. Selbständigerwerbende können sich bei der Pensionskasse ihres Personals, bei der Stiftung Auffangeinrichtung oder bei Vorsorgestiftungen des Berufsverbands versichern. Wir empfehlen hier die Verbandsvorsorgestiftungen für Ärztinnen und Ärzte und stellen Ihnen einen bedarfsgerechten Vorsorgeplan zusammen.
4.4 Private Altersvorsorge
Die persönliche Vorsorge ergänzen Sie am besten mit einer individuellen privaten Vorsorge in der Säule 3a und 3b. So können Deckungslücken bei Erwerbsunfähigkeit und im Todesfall optimal geschlossen werden. Zudem gilt es auch hier, Sparziele festzulegen und eine Strategie zu definieren, wie diese erreicht werden können.
5. Persönliche Beratung
Uns ist klar, der Versicherungsbereich ist komplex und nur eine Hürde von vielen auf dem Weg zur eigenen Praxis. Vertrauen Sie darum auf unsere Unterstützung und Erfahrung. Unsere Berater begleiten Sie in der ganzen Schweiz persönlich und individuell. Sie profitieren von massgeschneiderten ärztespezifischen Lösungen sowie in vielen Bereichen von exklusiven Rahmenvertragskonditionen.
Zur Person
Roger Ledermann ist Versicherungsfachmann und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Roth Gygax & Partner AG*
Moosstrasse 2
3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00
mail@fmhinsurance.ch
www.fmhinsurance.ch
*Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Cyberattacken im Gesundheitswesen: So handeln Sie richtig
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Ihre Praxis oder Institution vor Cyberattacken schützen und wie Sie sich im Ernstfall richtig verhalten.
Digitale Hilfsmittel erleichtern Gesundheitsfachpersonen die Praxisadministration und verhelfen Prozessen im Arbeitsalltag zu mehr Effizienz. Doch leider bringt die Digitalisierung auch neue Risiken und Bedrohungen mit sich. Denn auch das Gesundheitswesen gerät vermehrt ins Visier von Cyberkriminellen.
Im Rahmen der Digitalisierung nehmen Cyberattacken immer mehr zu. Dass sie jede und jeden treffen können – auch Arztpraxen, Spitäler oder andere Institutionen des Gesundheitswesens –, ist leider eine Tatsache. Denn einerseits ist das Gesundheitswesen mit seinen sensiblen Daten ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle, andererseits werden die Opfer dieser Angriffe oft eher zufällig als systematisch ausgewählt.
Verteidigung beginnt vor dem Angriff
Personen und Institutionen, die mit sensiblen Daten zu tun haben, tragen eine Mitverantwortung für die Sicherheit ihrer Systeme und Daten. Deshalb ist es essenziell, präventive Vorkehrungen zu treffen, um das Sicherheitsniveau der IT-Systeme und somit der Daten möglichst hoch zu halten. Zudem gilt: Je schwieriger es für Cyberkriminelle ist, eine Institution anzugreifen, desto weniger attraktiv wird diese als Ziel einer Cyberattacke.
Die wichtigsten Schutzmassnahmen lassen sich in drei Kategorien einteilen:
1. Technische Vorkehrungen
Zu den technischen Vorkehrungen gehört unter anderem der Schutz von Arbeitsgeräten mit einer Firewall und einem Virenscanner. Ausserdem ist es wichtig, Updates von Betriebssystemen, Webbrowsern und Virenschutzprogrammen immer umgehend zu installieren, um mögliche Sicherheitslücken sofort zu schliessen. Die FMH hat dazu ein Dokument [1] herausgegeben, das Praxisärztinnen und -ärzten einen guten Anhaltspunkt für ihre Praxisinformatik gibt. Es beinhaltet Anforderungen, die ein Mindestniveau an Sicherheit für Daten, Informationen und die IT-Infrastruktur sicherstellen.
2. Organisatorische Vorkehrungen
Unter organisatorischen Vorkehrungen versteht man die Implementierung von Prozessen und Weisungen durch den/die Praxisinhaber/in. Beispiele sind das Durchführen regelmässiger Backups oder Weisungen an die Mitarbeitenden bezüglich der Handhabung von Daten und Systemen.
3. Verhaltensbezogene Massnahmen
Selbst eine sichere IT-Infrastruktur kann keinen 100-prozentigen Schutz vor Cyberattacken garantieren. Und schafft es ein Phishing-Mail, die Antivirus-Software zu umgehen und im Postfach der Arztpraxis zu landen, ist es die Person vor dem Computer, die den Unterschied ausmacht: Öffnet sie den virenverseuchten Anhang der Nachricht nicht und kontaktiert stattdessen den IT-Verantwortlichen, kann sie grossen Schaden verhindern. Aus diesem Grund sind regelmässige Schulungen und die Sensibilisierung der Mitarbeitenden für das Thema IT-Sicherheit unerlässlich.
Richtiges Verhalten bei einer Cyberattacke
Eine sichere IT-Infrastruktur und gut geschulte Mitarbeitende machen Cyberkriminellen das Leben schwer und verringern die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Cyberattacke auf die entsprechende Institution. Dennoch sollten alle Mitarbeitenden auch wissen, wie sie sich im Falle eines Angriffs verhalten sollen. Denn in einer solchen Situation gilt es effizient und zeitnah zu handeln. Unsere Empfehlung: Stellen Sie Ihren Mitarbeitenden ein Merkblatt mit den wichtigsten Sofortmassnahmen bereit. Dieses sollte auch den Kontakt enthalten, an den sie sich im Ernstfall wenden können.
Zu Ihrer Unterstützung hat HIN eine Checkliste mit Sofortmassnahmen erarbeitet. Einige wichtige Punkte daraus:
- Schnell handeln: Warten Sie beim Verdacht auf einen Angriff nicht ab, sondern handeln Sie sofort.
- Infizierte Geräte vom Netzwerk trennen: Schalten Sie WLAN-Adapter aus und stecken Sie bei Geräten, die mit einem Netzwerkkabel verbunden sind, dieses Kabel aus. Lassen sich die infizierten Geräte nicht eindeutig identifizieren, trennen Sie das gesamte Netzwerk vom Internet.
- Nachricht löschen: Löschen Sie die Nachricht mit dem schädlichen Anhang aus allen E-Mail-Konten, auch aus dem Papierkorb.
- Informieren: Informieren Sie alle an den Arbeitsstationen tätigen Personen. So stellen Sie sicher, dass die Nachricht mit dem schädlichen Anhang auf keinem weiteren Gerät geöffnet wird.
- IT-Partner zu Rate ziehen: Involvieren Sie Ihren IT-Partner oder -Support. Dieser kann das Ausmass des Schadens abwägen und Sie beim weiteren Vorgehen unterstützen.
- Vorfall melden: Wir empfehlen, den Cyberangriff dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) zu melden.
Die gesamte Checkliste finden Sie hier: www.hin.ch/cyberattacke
Lösegeldzahlung: Ja oder nein?
Eine häufige Angriffsmethode ist der Verschlüsslungstrojaner, auch «Ransomware» genannt. Sind Sie von einem Angriff durch Ransomware betroffen, werden die Daten auf Ihrem Arbeitsgerät verschlüsselt und Sie können nicht mehr darauf zugreifen. In diesem Fall werden Sie in der Regel aufgefordert, ein Lösegeld zu bezahlen, damit man Ihnen den Zugang auf die Daten wieder ermöglicht. Dies ist jedoch wenig empfehlenswert, da die Zahlung keine Garantie für den Wiedererhalt Ihrer Daten ist. Ausserdem trägt Ihr Geld dazu bei, dass die Täter ihre Angriffsmethoden weiterentwickeln können und zu weiteren Angriffen animiert werden. Auch in Bezug auf Ransomware gilt: Vorsorge ist die beste Verteidigung. Investieren Sie in eine vollständige Backup-Lösung für Ihre Praxis oder Institution, um im Ernstfall nicht um Ihre Daten fürchten zu müssen. Optimalerweise besprechen Sie das Backup mit Ihrem IT-Partner oder -Support.
Quellenverzeichnis
[1] «Minimalanforderungen IT-Grundschutz der FMH für Praxisärztinnen und- Praxisärzte», zu finden unter www.fmh.ch/dienstleistungen/e-health/itgrundschutz.cfm
Interessante Artikel
1. https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/infos-fuer/infosunternehmen/aktuelle-themen/cyberangriffe-gegen-firmen.html
2. https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/infos-fuer/infosunternehmen/aktuelle-themen/schuetzen-sie-ihr-kmu.html
3. https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/infos-fuer/infosunternehmen/vorfall-was-nun/ransomware.html
Zur Person
Uwe Gempp, CSO & IT-Architekt
Health Info Net AG
Seidenstrasse 4
8304 Wallisellen
Telefon 0848 830 740
uwe.gempp@hin.ch
www.hin.ch
Plötzlich Arbeitgeber: Kompetente Personal- und Lohnadministration
Mit der Eröffnung oder Übernahme einer Arztpraxis übernehmen Jungunternehmer Verantwortung für Personal und somit auch Pflichten.
Bei der Lohnadministration spielen nebst arbeitsrechtlichen Aspekten zusätzlich das Steuer- sowie das Sozialversicherungsrecht eine wichtige und nicht zu unterschätzende Rolle. Darum ist profundes Wissen und sorgfältiges Arbeiten von zentraler Bedeutung. Josia Röhm, Vertrauenspartner FMH Services (Treuhand) und Leiter Treuhand bei der TRETOR AG*, gibt Auskunft.
Herr Röhm, Sie unterstützen Ärztinnenund Ärzte bei der korrekten Abwicklung der Personal- und Lohnadministration. Welche grundsätzliche Empfehlung geben Sie Jungunternehmer beim Eintritt in die Selbständigkeit mit auf den Weg?
Die Wahrung der Gesetzeskonformität im Zusammenhang mit der Personal- und Lohnadministration über die gesamte Anstellungsdauer bildet ein zentrales Element der Praxisfinanzen. In Zeiten des Fachkräftemangels ist gut qualifiziertes Personal für Dienstleister ein sehr wichtiger Faktor. Das Vertrauen in eine funktionierende Personaladministration stärkt die Zufriedenheit von Mitarbeitenden und somit auch die Zufriedenheit von Patientinnen und Patienten.
Was gilt es bei der Übernahme von Mitarbeitenden zu berücksichtigen?
Im Rahmen einer Praxisübernahme gehen die Anstellungsverhältnisse des bisherigen Personals, sofern dieses es nicht ablehnt, mit allen Rechten und Pflichten auf den neuen Praxisinhaber über. Dieser haftet mit dem alten Praxisinhaber solidarisch für die Forderungen der Arbeitnehmenden, auch wenn diese bereits vor dem Übergang fällig geworden sind. Deshalb ist diesem Element in einem Praxisübernahmevertrag besondere Beachtung zu schenken.
Welche Form des Arbeitsvertrages ist erforderlich und was wird darin geregelt?
Obwohl in der Schweiz ein Arbeitsvertrag auch mündlich zustande kommen kann, ist die Schriftlichkeit jederzeit zu bevorzugen. Nebst den üblichen Punkten wie der Dauer des Anstellungsverhältnisses, dem Pensum und dem Lohn empfiehlt es sich, darin folgende wichtige Punkte zu regeln (nicht abschliessend):
- Betriebliche Arbeitszeit und Abgeltung von Überstunden
- Sorgfaltspflicht des Arbeitnehmers und Wahrung des Berufsgeheimnisses
- Lohnfortzahlung bei Krankheit, Unfall, Mutterschaft
- Pikettdienst
- Ferien und Urlaubstage
- Kündigungsfristen
Bei grösseren Praxen können allgemeingültige Punkte auch in einem separaten Anstellungsreglement geregelt werden. Die Anstellungsverhältnisse von Lernenden richten sich nach den kantonalen Empfehlungen.
Was ist nebst der Erstellung des Arbeitsvertrags bei der Anstellung zusätzlich zu beachten?
Bei ausländischen Mitarbeitenden ist gemäss Ausweis und aktuellen Verhältnissen die Quellensteuerpflicht zu überprüfen, dies gilt ebenfalls für Grenzgänger. Eine vollständige und pünktliche Kommunikation der jeweiligen Personaldaten ist unerlässlich, da für die korrekte Ablieferung der Quellensteuer der Arbeitgeber haftet.
Welche sind entscheidende Punkte während der Dauer des Anstellungsverhältnisses?
- Die zeitgerechte und korrekte Lohnauszahlung ist oberstes Ziel als Arbeitgeber.
- Wo immer möglich sollen Monatslöhne vereinbart werden, da diese in der allgemeinen Lohnabwicklung sowie für die Abwicklung der Sozialversicherungen weniger fehleranfällig sind.
- Die Mitarbeitenden sind stets darauf aufmerksam zu machen, dass sie Änderungen der persönlichen Situation mitteilen, damit allfällige Mutationen in der Lohnbuchhaltung vorgenommen werden können (z. B. Heirat, Umzug, etc.).
- Gewährte Spesen und Zulagen sind vorgängig auf die Vereinbarkeit mit dem Steuer- und Sozialversicherungsrecht zu prüfen.
- Unerwartete Ansprüche an die Auszahlung von Überstunden können dann entstehen, wenn die Arbeitszeiterfassung nicht oder nicht lückenlos geführt und insbesondere kontrolliert wird. Hierfür besteht eine gesetzliche Aufzeichnungspflicht, die in den vergangenen Jahren deutlich an Gewicht zugenommen hat.
- Korrekte und transparente Anwendung und Umsetzung von Lohnfortzahlungen bei unverschuldeter Abwesenheit infolge Krankheit, Unfall oder Mutterschaft.
- Am Jahresende gilt es, mit den Sozialversicherungen korrekt abzurechnen und einen richtigen Lohnausweis zu erstellen. Nicht selten stellen wir fest, dass gerade der Erstellung des Lohnausweises, dem der Stellenwert einer Urkunde zukommt, zu wenig Beachtung geschenkt wird.
Was ist für die Beendigung eines Anstellungsverhältnisses relevant?
Nach Beendigung der Probezeit kann ein Anstellungsverhältnis entweder in gegenseitigem Einvernehmen aufgehoben oder von einer der beiden Parteien innerhalb der vertraglichen Kündigungsfrist gekündet werden. Der Arbeitgeber hat zu berücksichtigen, dass das Anstellungsverhältnis seitens des Arbeitgebers nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt gekündet werden darf. Es gibt sogenannte Unzeiten, während derer eine allfällige Kündigung nichtig ist. Ein Austritt muss bei der zuständigen Pensionskasse gemeldet werden. Zudem sind mit der letzten Lohnabrechnung allfällige Überstunden oder Restferien abzurechnen.
Zur Person
Josia Röhm ist Dipl. Wirtschaftsprüfer und BSc in Betriebsökonomie
TRETOR AG*
Industriestrasse 7
4410 Liestal
Telefon 061 926 83 83
mail@fmhtreuhand.ch
www.fmhtreuhand.ch
*TRETOR AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Das ärztliche Rezept: To be or not to be digital
Wir beleuchten die Vorteile eines E-Rezeptes und ab wann dieses in der Schweiz einsetzbar ist.
Seit September 2022 müssen Apotheken in Deutschland ein elektronisches Rezept (E-Rezept) einlösen können. Was in Deutschland noch nicht ganz reibungslos funktioniert, ist in anderen europäischen Ländern schon seit mehreren Jahren etabliert [1,2]. Auch in der Schweiz ist insbesondere im Bereich der telemedizinischen Betreuung von Patientinnen und Patienten das Bedürfnis gewachsen, Rezepte elektronisch an eine Apotheke zu übermitteln. Immerhin geben im Swiss eHealth Barometer 35% der befragten Arztpraxen an, Rezepte den Apotheken auf elektronischem Wege zukommen zu lassen [3].
Der Bund hat mit der Revision des Heilmittelgesetzes die Minimalanforderungen an ein elektronisches Rezept festgelegt. Damit sollen auch im EPD Rezepte standardisiert abgelegt und abgerufen werden können. Dies hat jedoch einen Haken: Gemäss Arzneimittelverordnung müssen Rezepte in Papierform eigenhändig unterschrieben sein. Die elektronische Form bedingt eine qualifizierte Signatur oder eine Übermittlung, welche die Anforderungen an eine qualifizierte elektronische Signatur erfüllt. Weiterhin kann mit der derzeitigen technischen Infrastruktur des EPD keine Logik für die Validierung von Rezepten umgesetzt werden. Somit sind Lösungen zu suchen, mit denen ein Rezept mit einer rechtskonformen Unterschrift versehen und im EPD abgelegt werden kann.
Mit dem E-Rezept versprechen sich Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker Vorteile gegenüber einer Papierlösung. So ist ein häufig erwähntes Argument für das E-Rezepte die verbesserte Lesbarkeit von Rezepten [4]. Ein weiteres Argument ist die Vermeidung von Rezeptmissbrauch. Schliesslich soll mit dem E-Rezept die Adhärenz oder Therapietreue der Patientinnen und Patienten verbessert werden können [5]. Um es gleich vorwegzunehmen: Für viele der genannten Vorteile gibt es heute gut funktionierende Prozesse und Schutzmechanismen. Beispielsweise werden zunehmend Rezepte mit dem Praxissoftwaresystem ausgestellt und ausgedruckt oder mittels sicheren E-Mail versendet und somit wird die Lesbarkeit erhöht. Auch werden in Schweizer Apotheken effektive Massnahmen wie Bezugssperren für Betrüger eingesetzt, um dem Missbrauch vorzubeugen.
Was sind nun die Vorteile eines E-Rezepts für Patientinnen und Patienten wie auch die abgabeberechtigten Gesundheitsfachpersonen?
Steht ausschliesslich die Digitalisierung des Rezepts in Papierform im Vordergrund, kann ein E-Rezept nicht punkten. Der Mehrwert eines E-Rezepts liegt vielmehr in der Weiter- und Wiederverwendung von strukturierten Medikationsdaten, welche die Grundlage für die Unterstützung eines gesamtheitlichen Medikationsprozesses bilden. Die Mehrwerte für Ärztinnen und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker sind unter anderem:
- Kontrolle über das Rezept einschliesslich der Rückmeldung bei einer Einlösung
- Wiederverwendung der einmal erfassten Daten für den Medikationsplan
- automatische Kontrollen
- Vorbezug und/oder Übermittlung des verspäteten Rezeptes
- Vereinfachung von Teilbezügen oder die
- Unterstützung von Abrechnungsprozessen
Diese können nur dann effizient umgesetzt werden, wenn die Eingabe und Weiterverwendung einschliesslich der Mehrwert-Dienste in die Primärsysteme «nahtlos» integriert sind. Sobald Medikationsdaten händisch zwischen den Primärsystemen und den Mehrwert-Diensten übertragen werden müssen oder gar Medienbrüche entstehen, ist nicht nur die Bearbeitung zeitaufwändig, sondern auch anfällig für Übertragungsfehler.
Warum machen sich die Verbände FMH und pharmaSuisse für E-Rezept stark?
Der Medikationsprozess ist ein wichtiger Anwendungsfalls für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Sowohl innerhalb der Ärzteschaft als auch in der Bevölkerung stossen digitale Anwendungen zur Verbesserung und Unterstützung der korrekten Medikamenteneinnahme auf grosses Interesse [6]. FMH und pharmaSuisse engagieren sich dafür, eine einheitliche und rechtskonforme Lösung in der Schweiz einzusetzen. Diese Lösung muss so ausgestaltet sein, dass sie die Anforderung der Arzneimittelverordnungen hinsichtlich der elektronischen Signatur erfüllt aber auch im EPD genutzt werden kann. Nur ein einheitliches E-Rezept wird nach Auffassung der Verbände von der Bevölkerung wie auch von den abgabeberechtigten Gesundheitsfachpersonen akzeptiert. Mit dem E-Rezept möchten die Verbände die Digitalisierung im Gesundheitswesen in einem wesentlichen Bereich, der Medikation, fördern.
Wie funktioniert das E-Rezept von FMH und pharmaSuisse?
Das E-Rezept von FMH und pharmaSuisse setzt auf den Standard HL7-FIHR und einem Austauschformat, welches mit dem EPD kompatibel ist. Ausgestellt wird das E-Rezept in der Praxissoftware oder einer Webapplikation und mit der persönlichen HIN Identität des Ausstellers signiert. Das Ergebnis ist ein QR-Code, der alle Rezeptdaten sowie die Signatur des Ausstellers enthält. Der QR-Code kann dem Patienten auf Papier ausgedruckt mitgegeben, per Secure-Mail an den Patienten oder die (Versand-) Apotheke gesendet, oder im EPD bereitgestellt werden. Eingelöst wird das E-Rezept in der Apotheke, indem der QR-Code des E-Rezept mit dem bestehenden Barcode-Scanner eingescannt wird. Dabei wird das E-Rezept ausgelesen und die Angaben können in die Apothekensoftware übernommen werden. Anhand der Signatur kann die Apotheke die Gültigkeit des Rezepts jederzeit überprüfen, es validieren, die Verschreibung ausführen und das Rezept vollständig oder zum Teil entwerten. Hierzu erhält jedes ausgestellte E-Rezept eine nicht auf den Patienten rückführbare eindeutige Identifikationsnummer, die zusammen mit Transaktionsdaten zentral gespeichert werden. In keinem Fall werden personenbezogene Daten zentral gespeichert.
Wann ist das E-Rezept in der Schweiz verfügbar?
Das E-Rezept der Verbände ist bereits heute technisch einsetzbar. Damit es schweizweit genutzt werden kann, muss es in allen Apotheken in der Schweiz eingelöst werden können. Nur so ist die Wahlfreiheit für Patientinnen und Patienten gegeben, die im Heilmittelgesetz verankert ist. Aktuell finden in verschiedenen Regionen Pilotprojekte statt, in denen die Verbandslösung erprobt und stetig weiterentwickelt sowie verbessert wird. Die Pilot-Verbandslösung nutzt die Signaturenlösung HIN Sign und die Medikationssoftware Documedis und setzt auf den Standard CHMED16A, der durch den Verein IG eMediplan gepflegt wird [7]. Die Verfügbarkeit und die Benutzerfreundlichkeit sind Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche und flächendeckende Einführung des E-Rezepts. Designprobleme können nicht nur neue Arten von Fehlern erzeugen sondern auch zum Abbruch der Nutzung des E-Rezepts führen [8]. Parallel dazu müssen die Anliegen und Bedürfnisse alle am Medikationsprozess direkt oder indirekt beteiligten Organisationen und Verbände abgeholt werden. Dies benötigt Zeit.
Zur Person
Reinhold Sojer ist Leiter Abteilung Digitalisierung/eHealth der FMH.
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH
Elfenstrasse 18
3006 Bern
Telefon 031 359 11 11
info@fmh.ch
www.fmh.ch
Quellenverzeichnis
[1] L. Patrao, R. Deveza, and H. Martins, “PEM-A New Patient Centred Electronic Prescription Platform,” Procedia Technol., vol. 9, pp. 1313–1319, 2013, doi: https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.147
[2 ]M. Sääskilahti, A. Ojanen, R. Ahonen, and J. Timonen, “Benefits, Problems, and Potential Improvements in a Nationwide Patient Portal: Cross-sectional Survey of Pharmacy Customers’ Experiences.,” J. Med. Internet Res., vol. 23, no. 11, p. e31483, Nov. 2021, doi: 10.2196/31483
[3] L. Golder, “Swiss eHealth Barometer 2021,” 2021. [Online]. Available: https://www.gfsbern.ch/wp-ontent/uploads/2021/06/213111_ehealth_schlussbericht_gesundheitsfachpersonen-und-akteure-des-gesundheitswesens. pdf
[4] T. A. Meyer, “Improving the quality of the order-writing process for inpatient orders and outpatient prescriptions.,” Am. J. Heal. Pharm. AJHP Off. J. Am. Soc. Heal. Pharm., vol. 57 Suppl 4, pp. S18-22, Dec. 2000, doi: 10.1093/ajhp/57.suppl_4.S18
[5] D. Aluga, L. A. Nnyanzi, N. King, E. A. Okolie, and P. Raby, “Effect of Electronic Prescribing Compared to Paper-based (Handwritten) Prescribing on Primary Medication Adherence in an Outpatient Setting: A Systematic Review.,” Appl. Clin. Inform., vol. 12, no. 4, pp. 845–855, Aug. 2021, doi: 10.1055/s-0041-1735182
[6] V. Pfeiffer and R. Sojer, “«There is an App for That»: Zukunft oder a¨rztlicher Alltag?,” Schweizer Ärztezeitung, vol. 103, no. 31–32, pp. 962–965, 2022
[7] eHealth Suisse, “eMedication in the context of the Electronic Patient Record,” 2020. Accessed: Oct. 12, 2022. [Online]. Available: https://www.ehealth-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/E/report-medicationarchitecture-epr.pdf
[8] A. Porterfield, K. Engelbert, and A. Coustasse, “Electronic prescribing: improving the efficiency and accuracy of prescribing in the ambulatory care setting.,” Perspect. Heal. Inf. Manag., vol. 11, no. Spring, p. 1g, 2014
Versicherung, Vorsorge, Vermögen: Pensionskasse – was gilt es zu beachten?
Wer eine Praxis eröffnen oder übernehmen will, benötigt eine Reihe von Versicherungen. Ein wichtiges Element in diesem «Absicherungspuzzle» stellt die Pensionskasse dar.
Nebst einer Berufshaftpflicht-, einer Rechtsschutz- oder einer Sachversicherung gilt es auch das Personal sowie die Praxisinhaberin oder den Praxisinhaber umfassend abzusichern. Was es hierbei zu beachten gilt, wollten wir von Herrn Sergio Kaufmann, Vorsorge- und Finanzplanungs-Spezialist, wissen.
Herr Kaufmann, warum ist eine Pensionskasse bei der Praxisgründung oder -übernahme wichtig und empfehlenswert?
Die Praxisinhaberin resp. der Praxisinhaber wird einerseits auf einmal zum Arbeitgeber und muss alle Angestellten mindestens gemäss den gesetzlichen Vorgaben versichern. Nebst der Anmeldung bei einer AHV-Ausgleichskasse wird eine obligatorische Unfallversicherung (UVG) und ab einem Jahreseinkommen von CHF 21'330 auch ein BVG-Anschluss benötigt.
Anderseits wechselt die Ärztin resp. der Arzt häufig aus einer Anstellung in eine Selbstständigkeit. Die bisher vom Arbeitgeber gewährten Deckungen fallen weg, und die persönliche Vorsorge muss selbst organisiert werden. Es gilt hier den notwendigen Schutz bei Erwerbsunfähigkeit zu versichern, die Hinterbliebenen bei einem Todesfall abzusichern und das eigene Alterssparen nicht ausser Acht zu lassen. Der Anschluss an eine Pensionskasse bietet dafür eine attraktive Möglichkeit.
Worauf sollte man bei der Wahl einer Pensionskasse für die Angestellten Achtgeben?
Grundsätzlich lohnt sich ein Vergleich der Risiko- und der Verwaltungskosten. Da die Beiträge in der Regel paritätisch, also je zur Hälfte, finanziert werden, profitiert sowohl der Arbeitgeber von tieferen Lohnnebenkosten wie auch die Arbeitnehmenden von einem höheren Nettolohn.
Zudem sollte der Anschluss bei einer soliden Pensionskasse erfolgen. Es lohnt sich z. B., den Deckungsgrad zu prüfen, einen Blick auf das Verhältnis zwischen aktiv Versicherten und Rentnern zu werfen oder die Verzinsung des Altersguthabens der letzten Jahre anzuschauen. Die Interpretation solcher Kennzahlen ist oft nicht so einfach, weshalb sich die Beratung durch einen Spezialisten empfiehlt.
Welche Möglichkeiten bieten sich selbstständigerwerbenden Ärztinnen und Ärzten, sich in einer Pensionskasse zu versichern?
Hier gibt es drei Möglichkeiten: Den Anschluss bei der Pensionskasse des Personals, einen Beitritt zur Stiftung Auffangeinrichtung oder eine Versicherung bei einer Stiftung des eigenen Berufsverbands. Die Stiftung Auffangeinrichtung ist nicht attraktiv und dient unter anderem für Personen, die sonst keinen Anschluss finden. Bei einem Anschluss bei der Pensionskasse des Personals sind die Wahlmöglichkeiten des Vorsorgeplans eingeschränkt, da in der Regel die gleichen Leistungen und Sparbeiträge wie beim Personal vereinbart werden müssen. Daher empfiehlt sich oft eine Versicherung über eine Verbandsvorsorgestiftung. Wir pflegen eine langjährige Partnerschaft mit den Verbandsstiftungen der Ärzteschaft und können unsere Kundschaft dahingehend umfassend beraten.
Spielt die Gesellschaftsform der Arztpraxis bezüglich der Pensionskasse eine Rolle?
Ja, weil bei Arztpraxen in Form einer juristischen Person wie AG oder GmbH die mitarbeitenden Inhaber auch als Angestellte gelten und daher auch dem Versicherungsobligatorium unterstehen. Sofern mehrere Ärzte gemeinsam eine Praxis führen, gilt es zudem die individuellen Vorsorgebedürfnisse unter einen Hut zu bringen und sich für eine gemeinsame Lösung zu entscheiden, was nicht immer ganz einfach ist. Zudem besteht bei einem Wechsel von einer Anstellung in eine Praxis-AG (oder GmbH) oft keine Möglichkeit, das bisherige Vorsorgeguthaben zu beziehen.
Können Sie das näher erläutern?
Im klassischen Fall bei einem Wechsel von einer Anstellung zu einer selbstständigen Tätigkeit empfiehlt es sich aus steuerlichen Gründen oder z.B. für eine Praxisfinanzierung, das bisherige BVG-Guthaben zu beziehen. Das Gesetz sieht diese Möglichkeit vor, jedoch eben nur für die Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit. Die Gründung einer AG beispielsweise führt zu einer Anstellung, wodurch das Guthaben nicht bezogen werden kann.
Zum Schluss, welchen Tipp haben Sie für angehende Praxisgründerinnen und Praxisgründer?
Der grösste Teil des Vorsorgeguthabens landet in der Regel früher oder später bei einer Pensionskasse. Lassen Sie sich daher von Anfang an unabhängig beraten, um die Weichen frühzeitig richtig zu stellen. Das Netzwerk von FMH Services ist dafür ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner.
Honorarabrechnung durch externe Dienstleister
Bei der aktuellen Angebotsvielfalt fällt eine Triage zur Ermittlung der preisgünstigsten Lösung eher schwierig aus. Ein paar Punkte die zu beachten sind.
Der Ärzteschaft stehen mit den Fachleuten von FMH Services (Factoring & Inkasso) erfahrene Berater zur Verfügung. Aufgrund seiner langjährigen Branchenerfahrung und fundierten Kenntnisse des Factoring- und Inkassomarktes haben wir Herrn Olivier Piguet zu diesem Thema ein paar Fragen gestellt.
Herr Piguet, mehr und mehr Abrechnungsdienstleister drängen in den Gesundheitsmarkt. Wie schätzen Sie die Situation ein?
Die Auslagerung des Debitorenmanagements, von der Honorarabrechnung bis zum Inkasso, an spezialisierte
Firmen liegt im Trend und ist für Arztpraxen sinnvoll und günstiger, als eigene Personalressourcen dafür zu binden. So kann die Praxis mehr Patienten aufnehmen und behandeln und den Fokus auf Kernaufgaben richten. Doch Vorsicht vor versteckten Kosten und Reputationsrisiken! Nicht alle Anbieter verfügen über genügend Erfahrung im Gesundheitsmarkt, und einige belasten die Patienten mit exzessiven Gebühren und Zinsen und gefährden so meiner Meinung nach den Ruf der betreffenden Praxen.
Wie meinen Sie das?
Ein Beispiel: Gewisse Factoring-Anbieter operieren mit einer Gebühr von 1 % auf dem abgerechneten Honorar, und zwar nicht zeitlich begrenzt als Promotion, sondern fix. Das ist kaum wirtschaftlich, weshalb ein Teil der anfallenden Kosten auf die Patienten abgewälzt wird, welche nebst hohen Zinsen (z. B. für Verzug oder Ratenzahlung) auch noch hohe Gebühren für Rechnungsstellung und Debitorenmanagement berappen müssen. Zudem werden viele Patienten für ein echtes Factoring abgelehnt, bzw. etwa jede zweite Arztrechnung wird gar nicht übernommen, und das Debitorenausfallrisiko bleibt beim Arzt. Besonders heikel finde ich ist, dass der an Patienten verrechnete Zins oft sehr hoch, zum Teil knapp unter der Wuchergrenze liegt und dass einzelne Anbieter die Patientendaten für Marketingzwecke an Dritte weiterleiten. Da muss sich die Ärzteschaft schon fragen, ob sie ihren Patienten solches zumuten will.
Und in der Inkassobranche?
Auch da gibt es ein paar schwarze Schafe. Die Ärzteschaft ist jedenfalls gut beraten, die vom jeweiligen Abrechnungsdienstleister beauftragten Inkassofirmen, samt AGB und Gebührentarifen, genau zu prüfen. Denn diese Themen sind bei Konsumentenschützern und in der einschlägigen Presse ein Dauerbrenner. Da genügt es nur ein bisschen nach Stichworten wie «Inkassogebühren» oder «Verzugsschaden» zu googeln, um fündig zu werden. Klar: Schulden und entstandene Mehrkosten müssen vom Verursacher getilgt werden. Doch gebührt säumigen Patienten, welche meist ohne eigenes Verschulden (Unfall, Krankheit) in einen finanziellen Engpass geraten, ein gewisses Augenmass im Forderungseinzug.
Was ist bei der externen Honorarabrechnung zu beachten?
Man sollte von allen relevanten Anbietern ein Angebot einholen und sich nicht auf Meinungen von Kolleginnen und Kollegen beschränken, selbst wenn diese in der gleichen Fachrichtung praktizieren. Jede Praxis hat individuelle Bedürfnisse an Liquidität, Soft- & Hardware, Versicherungen, Praxisgestaltung usw. Fehlentscheide können in der Folge kostspielig sein. Das Thema ist komplex, und die Unterschiede zwischen den Anbietern sind gross. Grundsätzlich: sich nicht blenden lassen. Eine tiefe Servicegebühr garantiert noch keine tiefen Gesamtkosten. Gewisse Anbieter klammern einige Gebühren (z. B. für Rechnungsdruck, Mahnservice, Versand von Unterlagen etc.) explizit aus oder bieten gewisse Dienste gar nicht an. Diese Aufwände werden gesondert und nicht gerade billig nachfakturiert und summieren sich in der Jahresrechnung. Auch zu klären gilt, wie lange man sich vertraglich bindet. Ob man die freie Wahl der Praxis-Software geniesst oder an die Nutzung einer bestimmten Lösung gebunden wird. Bei einem späteren Anbieter- oder Softwarewechsel kann sich dies nachteilig auswirken, wenn die Patientendaten transferiert werden müssen.
Was ist sonst noch wichtig?
Wie schnell erhalten Sie Ihr Honorar? Noch am gleichen Tag der Abrechnung oder erst nach Wochen? Wird Ihr Honorarguthaben verzinst? Handelt es sich um echtes Factoring oder nur um eine beschränkte Vorfi nanzierung? Dies sind nur einige wenige Fragen, welche, insbesondere bei Praxisneugründungen mit hohem Liquiditätsbedarf, relevant sind. Kann das Inkasso ausgeklammert werden, um den Dienstleister selbst zu bestimmen? Dies ist bei einigen Abrechnungsdienstleistern ohne Weiteres möglich, so auch bei FMH Services (Factoring & Inkasso).
Neuengasse 5
2502 Biel/Bienne
Telefon 032 560 39 00
Steuerliche Unterschiede einer AG vs. Einzelfirma
Empfehlung? Sich über die möglichen Konsequenzen professionell beraten lassen.
Eine Praxis als Kapitalgesellschaft bzw. AG (Aktiengesellschaft) oder GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) zu betreiben, erscheint immer mehr Ärztinnen und Ärzten als attraktive Unternehmensform. Nebst sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Unterschieden während der Erwerbstätigkeit ergeben sich auch bei einer Nachfolgeregelung grosse Unterschiede zwischen einer Kapitalgesellschaft und der klassischen Einzelfirma.
Herr Ceccon, was gilt es insbesondere aus Sicht der Käuferin oder des Käufers bei der Übernahme einer AG oder GmbH zu beachten?
Als Beispiel betrachten wir den Kauf einer Praxis AG zum Wert von CHF 500‘000 bei einem Aktien-Nennwert von CHF 100‘000. Wobei Einrichtung und Geräte einen materiellen Wert von CHF 100‘000 aufweisen und der immaterielle Wert (Goodwill) CHF 400‘000 beträgt.
Die Käuferin oder der Käufer kauft die Kapitalgesellschaft mit dem Privatvermögen und besitzt sodann im Vermögen Aktien im Wert von CHF 500‘000. Sie oder er hat keine Möglichkeit, den Kaufpreis während der Erwerbsphase abzuschreiben. Am Ende der Erwerbsphase bestimmt der Markt, wie hoch die Aktien bewertet werden. Entweder erhält die Käuferin oder der Käufer den gleichen Veräusserungspreis, den er wie er damals bezahlt hat, oder es gibt bei tieferem Wert einen steuerfreien Kapitalverlust oder bei höherem Wert einen steuerfreien Kapitalgewinn.
Welche Vor- und Nachteile gibt es bei der Übernahme einer Einzelfirma?
Auch hier nehmen wir wieder das Beispiel einer Praxis, welche als Einzelfirma geführt wurde, mit einem materiellen Wert von CHF 100‘000 und einem immateriellen Wert (Goodwill) von CHF 400‘000.
Die Käuferin oder der Käufer der Praxis kauft die Praxis mit dem Privatvermögen und legt diese Investition in ihr/sein Geschäft (Privateinlage). Diese Investition wird in der Buchhaltung unter den Aktiven in zwei Positionen unterteilt, die CHF 100‘000 unter materiellen Werten und die CHF 400‘000.unter den immateriellen Werten. Nun kann sie/er diese Werte abschreiben, die materiellen Werte je nachdem zwischen 15 und 35% degressiv, den immateriellen Wert linear pro Jahr 1/5. Das sind um die CHF 100‘000 während den ersten 5 Jahren, welche gewinnmindernd und somit steuermindernd in Abzug gebracht werden können. Betrachten wir die Einkommenssteuern bei mittleren ärztlichen Einnahmen im kantonalen Durchschnitt, sind dies um 25% Steuerersparnis und rund 10% AHV-Ersparnis, was gut und gerne pro Jahr CHF 35‘000 an tieferen Abgaben (Steuern und AHV) ausmacht. Auf die Abschreibezeit von 5 Jahren der immateriellen Werte bezogen beträgt die gesamte Ersparnis rund CHF 175‘000.
Die Abschreibungen sind ebenfalls von der AHV befreit, da die AHV-Beiträge nur auf dem Gewinn nach Abschreibungen der Einzelfi rma erhoben werden.
Wieso diese unterschiedliche Behandlung und was ist aus Sicht des Gesetzgebers zu berücksichtigen?
Kapitalgewinne aus dem Verkauf von beweglichem privatem Vermögen (Wertpapiere) sind grundsätzlich steuerfrei. Dies gilt auch für Aktienanteile der eigenen AG. Demzufolge kann die Käuferin oder der Käufer keine Steuern in Abzug bringen.
Fazit bei Kauf einer Kapitalgesellschaft: Für die Steuerverwaltung bleibt der Kauf/Verkauf steuerneutral, grosser Vorteil für die Verkäuferin oder den Verkäufer, jedoch grosser Nachteil für die Käuferin oder den Käufer.
Bei der Einzelfi rma hingegen bezahlt die Verkäuferin oder der Verkäufer die privilegierte Liquidationssteuer und den AHV-Beitrag auf den Liquidationsgewinn. Im Gegenzug kann die Käuferin oder der Käufer Einkommenssteuer und AHV-Beiträge in Abzug bringen.
Fazit bei Einzelunternehmen: Für die Steuerverwaltung nachteilig, da das Delta der zu bezahlenden Liquidationssteuern versus die gesparten Einkommenssteuern gut und gerne 1/5 ausmachen kann, somit kleiner Nachteil für die Verkäuferin oder den Verkäufer, aber grosser Vorteil für die Käuferin oder den Käufer.
Was ist Ihre Empfehlung?
Verkäufer/in und Käufer/in sollten sich gemeinsam über die möglichen Konsequenzen bei einer Nachfolgeregelung und bei der Rechtsform beraten lassen.
Zur Person
Jean-Pierre Ceccon ist Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Financial Planner CFP© sowie Dipl. Steuerberater NDS HR
Ceccon Consulting & Partner AG*
Baselstrasse 10
4222 Zwingen
Telefon 061 261 08 08
mail@fmhtreuhand.ch
www.fmhtreuhand.ch
*Ceccon Consulting & Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Praxisübernahme: Achtung bezüglich Medikamentenverkauf
Eine Thematik, die im Rahmen der Vertragsverhandlungen bei einer Praxisübernahme darstellt und besprochen wie auch festgehalten werden muss.
Mit dem folgendem Artikel möchten wir die praxistätigen Ärztinnen und Ärzte bezüglich der Übergabe der in der Praxis gelagerten Medikamente an den/die Nachfolger/in sensibilisieren. Dabei machen wir angehende Praxisübernehmer und Praxisübernehmerinnen darauf aufmerksam, dass dies eine Thematik im Rahmen der Vertragsverhandlungen bei einer Praxisübernahme darstellt und besprochen wie auch festgehalten werden muss. Bitte beachten Sie, dass es dabei nicht um die Abgabe von Medikamenten an den Patienten geht (Selbstdispensation). Frau Geisseler, Juristin bei der FMH Services, gibt zu diesem Thema antworten.
Welches sind die gesetzlichen Grundlagen zur Medikamentenweitergabe zwischen Ärzten untereinander respektive zwischen ärztlichen Betrieben und Ärzten?
Gemäss der Verordnung über die Bewilligungen im Arzneimittelbereich (AMBV) benötigt ein Betrieb, welcher Arzneimittel, z. B. an einen anderen Arzt, weitergibt, eine Grosshandelsbewilligung (Art. 2 lit. l AMBV). Darin wird auch festgehalten, dass sowohl die entgeltliche als auch die unentgeltliche Übertragung von Arzneimitteln unter die Definition des Grosshandels fällt und somit einer Grosshandelsbewilligung bedarf. Dies unabhängig von der Anzahl der Übertragungen. Auch die Überlassung des Medikamentenlagers zum Einstandspreis im Rahmen einer Praxisübergabe ist somit ohne Grosshandelsbewilligung seitens des Praxisverkäufers nicht erlaubt. Die einzigen Ausnahmen stellen gemäss Art. 20 Abs. 2 AMBV die öffentlichen Apotheken, Spitalapotheken oder Drogerien dar.
Was heisst dies nun für den Vorgang bei einem Praxisverkauf?
Sofern der/die Praxisverkäufer/in die Medikamente direkt dem/der Käufer/in weitergeben würde, würde dies den Tatbestand des Grosshandels erfüllen, was lege artis einer Grosshandelsbewilligung bedarf. Sofern der/die Praxisverkäufer/in eine solche nicht hat, müssen andere Lösungen angewendet werden.
Was wäre das konkrete Vorgehen beim Praxisverkauf?
Konkret heisst dies für die eingelagerten Medikamente, dass für den Verkauf einer Arztpraxis bzw. eines Anteils an einer Arztpraxis der/die Verkäufer/in die Medikamente dem Medikamentenlieferanten zurückgeben muss. Der Verkäufer erstellt über die im Zeitpunkt der Übergabe bzw. an einem anderen von den Parteien vereinbarten Stichtag vorhandenen Medikamentenvorräte ein Inventar. Der/die Verkäufer/in klärt mit dem Medikamentenlieferanten frühzeitig, vor der Praxisübergabe, die Vorgehensweisebei der Übergabe der Medikamentenvorräte an den/die Käufer/in ab. Der Medikamentenlieferant hat danach die Medikamente dem/der Praxiskäufer/in zu verkaufen. Wir empfehlen, die genaue Vorgehensweise und die Zuständigkeiten der Medikamentenübergabe im Praxisübernahmevertrag entsprechend festzuhalten.
Wie erfolgt nun die Übergabe des bestehenden Medikamentenlagers an den Praxiskäufer aus der Sicht der «Bewilligung zum Führen einer ärztlichen Privatapotheke» bzw. der Bewilligung zur Selbstdispensation?
Die «Bewilligung zum Führen einer ärztlichen Privatapotheke» bzw. die Bewilligung zur Selbstdispensation kann nicht «mitverkauft» werden. Der/die Praxiskäufer/in hat eine solche Bewilligung bei der entsprechenden kantonalen Behörde vorzuweisen oder eine entsprechende Bewilligung zu beantragen. Die Bewilligung ist auf den Standort und personenbezogen ausgestellt. Aus der Sicht des Bewilligungsverfahrens empfehlen wir, diese Thematik entweder direkt bei der zuständigen kantonalen Behörde abzuklären oder allenfalls «anonym» über einen Berater abklären zu lassen.
Was gibt es sonst noch zu beachten?
Sobald es sich um eine Gruppenpraxis (Gemeinschaftspraxis) mit einem gemeinsamen Medikamentenlager handelt, gilt es ebenfalls gewisse Dinge bezüglich der Handhabung der Medikamente zu beachten. Dabei bedarf es aber einer genauen Analyse der jeweiligen kantonalen Vorgaben, der Praxis wie auch der persönlichen Situation. Gerne stehe ich dabei für individuelle Auskünfte zur Verfügung.
Rechnungskopie an Patienten: Kostendämpfungsmassnahme, aber für wen?
Wir klären über Herausforderungen und möglichen Lösungen auf, um damit verbundene Sanktionen zu verhindern.
Die Ende letzten Jahres vom Bundesrat verordnete Massnahme zur Dämpfung der Kosten im obligatorischer Krankenversicherungswesen (bzgl. obligatorische Rechnungskopie an Patientinnen und Patienten im Tiers-payant-system) trat per 1. Januar 2022 in Kraft. Es ist aber auch eine bekannte Tatsache, dass die verbindliche Übermittlung einer Rechnungskopie an Patienten/-innen im Tiers-payant-System seit langem vorgeschrieben war. Mit dem Bundesratsbeschluss wurde dieser Forderung nun Nachdruck verliehen, indem sie im KVG (Art. 42 Abs. 3 KVG) integriert und mit zum Teil starken Sanktionsmöglichkeiten verbunden wurde.
Herr Stampfli, dieser Bundesratsbeschluss hat bei allen beteiligten Parteien, der Ärzteschaft, den Praxissoftwareherstellern, den Abrechnungsunternehmen und selbstverständlich auch bei den Patienten/-innen, zahlreiche Aktivitäten ausgelöst. Können Sie uns dies erläutern?
Obschon es bei fast allen bekannt war, dass die Übermittlung einer Rechnungskopie an Patienten/-innen im Tiers-payant-System obligatorisch ist, wurde diese Pflicht in den letzten Jahren von vielen nicht ernst genommen und teilweise auch ignoriert. Dieser Umstand hat dann Anfang Jahr zu einer hohen Beschäftigung und einer gewissen Unsicherheit geführt. Das Gesetz schreibt eine Rechnungskopie vor, erlaubt aber auch, ohne genaue Präzisierung, eine elektronische Variante. Patienten/-innen, welche sich im Tiers payant daran gewöhnt hatten, ihrem Arzt zu vertrauen und von jeglichem administrativem Aufwand befreit zu sein, erhielten nun eine Rechnungskopie und fragten sich warum respektive wollen diese auch heute nicht.
Das sind jedoch unterschiedliche Situationen. Was sind die Herausforderungen bei der Ärzteschaft?
Die Ärzteschaft musste dieser verbindlichen Auflage umgehend nachkommen, was einen nicht zu unterschätzenden Mehraufwand bedeutet. Denn parallel zum elektronischen Versand der Honorarrechnung muss auch eine physische Kopie der Rechnung abgegeben oder versendet werden, was Druck- und Portokosten verursacht. Deshalb wurde umgehend eine Möglichkeit gesucht, die Honorarrechnung an die Patienten/- innen elektronisch zu versenden. Teilweise war das aber gar nicht möglich, da die Praxissoftwareprogramm dafür nicht vorbereitet war oder man es nicht auf den neusten Stand gebracht hatte. Um eine Rechnungskopie elektronisch zu versenden, bedarf es zwingend einer aktuellen, gültigen E-Mail-Adresse der Patienten/-innen. Viele Praxen hatten es verpasst, diese bei ihren Patienten/-innen einzuholen und aktuell zu halten. Oder das benutzte Praxissoftwareprogramm hatte kein Feld, um diese zu erfassen, oder das Weiterleiten mit den Rechnungsdaten war nicht gewährleistet.
Was meinen Sie genau mit der Verifizierung der E-Mail-Adresse?
Viele Patienten/-innen haben heute eine oder mehrere persönliche E-Mail-Adressen. Die Aufgabe der Praxis ist es, die E-Mail-Adresse, an welche die Kopie der Honorarrechnung zu senden ist, zu erfragen und korrekt in der Praxissoftware zu erfassen. Ob diese E-Mail-Adresse dann überprüft wird oder versendete E-Mails beim korrekten Empfänger ankommen, obliegt der Praxis. Im Weiteren ist es wichtig, dass die Patienten/-innen ihr Einverständnis geben, auf dieser E-Mail-Adresse ihre Rechnungskopie zu empfangen. Dies sollte aus Gründen der Rechtssicherheit immer mit Unterschrift bestätigt werden. Ob diese Verifizierung den strengen Datenschutzanforderungen genügt, ist nicht restlos geklärt. Auf der anderen Seite wird durch ein Vorgehen, welches von den Patienten/-innen zusätzliche Authentifikationsschritte fordert, zum Beispiel sich auf einem Portal zu registrieren und die Rechnungskopien innerhalb einer bestimmten Frist von dieser Plattform herunterzuladen, die Zustellung der Rechnungskopie verkompliziert. Dazu entstehen auch hohe Kosten für die Ärzteschaft, wenn die Patienten/-innen ihre Rechnungskopien auf diesem Weg nicht abholen, denn danach folgt der Versand der Rechnung per Post.
Welche Lösung bietet die FMH Services (Factoring) für diese Herausforderung?
Wir bieten der Ärzteschaft eine einfache und pragmatische Lösung. In der Kombination mit unserem Honorarabrechnungsdienst werden uns von der Praxis die Abrechnungsdaten inklusive der E-Mail-Adresse elektronisch übermittelt. So können wir den Patienten/-innen eine Rechnungskopie kostenfrei per E-Mail zustellen. Das ist für alle Beteiligten eine einfache, praktische und günstige Lösung.
Quellen: www.fmh.ch/www.bag.admin.ch
Zur Person
Jean-Michel Stampfli ist Leiter Vertrieb & Vertriebsmarketing bei mediserv AG*
mediserv AG*
Neuengasse 5
2502 Biel/Bienne
Telefon 032 560 39 00
mail@fmhfactoring.ch
www.fmhfactoring.ch
*Die mediserv AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Factoringunternehmen.
Professionelle Finanzplanung als Basis für eine erfolgreiche Praxistätigkeit
Das derzeitige Unternehmensumfeld im Gesundheitswesen ist von hoher Komplexität geprägt.
Damit sich ein Jungunternehmer optimal und realistisch auf die selbstständige Tätigkeit in der eigenen Praxis vorbereiten sowie das unternehmerische Risiko überblicken kann, ist ein professioneller Finanzplan unabdingbar.
Herr Picht, seit Jahren unterstützen Sie Ärztinnen und Ärzte bei der Erstellung eines Finanzplans und bei der Sicherstellung der Finanzierung für den geplanten Weg in die Selbstständigkeit. Welches sind aufgrund Ihrer Erfahrung die wichtigsten Vorteile eines Finanzplans?
Gegenüber jungen Ärzten, die an uns gelangen, betone ich oft, dass die Bedeutung eines solchen Plans für sie persönlich am grössten ist. Am Ende des Finanzplanungsprozesses muss sich der Arzt über seine zukünftige Tätigkeit sicher sein, das Potenzial der Praxis kennen und auch wissen, wie gut er in der Lage sein wird, seinen Lebensunterhalt mit der Praxistätigkeit zu bestreiten. Es versteht sich von selbst, dass der Arzt die volle Verantwortung für seinen Finanzplan gegenüber einer Bank oder anderen Geldgebern übernimmt.
Wie können wir uns einen solchen Finanzplan vorstellen? Und wie geht man am besten vor?
Grundsätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass ein Finanzplan nie ganz korrekt sein wird. Also nehmen wir uns wenigstens die Zeit, ihn möglichst realitätsnah abzubilden. Denn eine Zukunftsprognose hängt von vielen Faktoren ab, deren Entwicklung häufig unbekannt ist. Es existiert jedoch eine Anzahl von Hypothesen, mit welchen ein gut durchdachter Plan erstellt werden und die Unsicherheit minimiert werden kann. Beim ersten Gespräch stelle ich eine Zusammenstellung der Elemente, die bewertet werden sollen, zur Verfügung. Diese hat sich im Laufe der Jahre meiner Tätigkeit kontinuierlich erweitert.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass jeder Fall einzigartig ist. Ein Arzt, der die Praxis eines pensionierten Kollegen übernimmt, hat nicht die gleichen Perspektiven wie ein Arzt, der seine Praxis an einem hart umkämpften Standort eröffnet – selbst wenn beide der gleichen Fachrichtung angehören.
Welche Punkte sind aus Ihrer Sicht die kritischsten und wie können junge Ärztinnen und Ärzte von Ihrer langjährigen Erfahrung profitieren?
Aus meiner Sicht ist der kritischste Punkt der Cashflow-Plan. Viele Ärzte sind beunruhigt über die Anfangsinvestitionen und die langfristige Rentabilität ihrer Praxis. Aber sie sind sich nicht immer bewusst, dass die Finanzierung für den Beginn ihrer Praxistätigkeit notwendig ist. Die ersten Monate sind die wichtigsten: Die Investitionen sind getätigt und die Kosten vorhanden, während der Patientenstamm zum grössten Teil erst nach und nach wächst. Aus diesem Grund besteht in den ersten Monaten ihrer Tätigkeit ein erhöhter Finanzierungsbedarf.
Zudem unterscheidet sich ein Finanzplan eines Arztes in einer Einzelpraxis von einem Arzt, der in einer Gemeinschaftspraxis tätig ist. Im letzteren Fall müssen auch die Berechnung und die Umlage der gemeinsamen Kosten berücksichtigt werden.
Was ist entscheidend für die Qualität eines Finanzplans?
Der Arzt muss sich genügend Zeit nehmen, über die Inhalte des Finanzplans nachzudenken und diese pragmatisch und realistisch einzuschätzen. Ist ein Finanzplan zu pessimistisch, kann die Machbarkeit der Finanzierung von den Geldgebern verkannt werden und den Arzt entmutigen. Anderseits kann bei einem zu optimistischen Plan die Notwendigkeit zur Finanzierung unterschätzt werden, was den Arzt dazu zwingt, zu einem späteren Zeitpunkt bei der Bank eine Verlängerung des Kredits zu beantragen. Das sehen die Banken überhaupt nicht gerne.
Was ist nebst einem professionellen Finanzplan wichtig, um den Erfolg eines Unternehmens sicherzustellen?
Der Finanzplan ist kein Selbstzweck, sondern er ist der momentane Ausdruck einer möglichen künftigen Realität. Sobald die Praxis eröffnet wurde, gewinnt die Realität die Oberhand. Deshalb ist es immer sehr interessant, den erarbeiteten Plan einige Monate nach Beginn der Praxistätigkeit mit der Realität zu vergleichen. Die Tätigkeit in einer Arztpraxis nimmt keinen ruhigen Verlauf, sondern erfordert höchste Aufmerksamkeit. Antizipation ist das Schlüsselwort: die Fähigkeit, mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und den Kurs entsprechend zu korrigieren, ermöglicht es der Praxis (und damit auch dem Arzt), sich den möglichen Stürmen des Lebens zu stellen. Vergessen wir nicht: In den meisten Fällen verfügt ein Arzt, der sich neu in die Selbstständigkeit begibt, über keinerlei betriebswirtschaftliche Erfahrung. Neben immer wichtiger werdenden Aufgaben in der täglichen Praxistätigkeit ist dies eine grosse Herausforderung.
Zur Person
Michel Picht hat den Master in Wirtschaftwissenschaften (HSW)
Anthill Sàrl*
Route de la Chaux 4
1030 Bussigny
Telefon 021 634 26 60
mail@fmhtreuhand.ch
www.fmhtreuhand.ch
*Anthill Sàrl ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Geschäftsliegenschaften im Privatvermögen vs. Geschäftsvermögen
Aus steuerrechtlicher Sicht gibt es zahlreiche Unterschiede und Besonderheiten zu beachten. Eine frühzeitige und fundierte Beratung ist dabei von Vorteil.
Liegenschaften können im Privatvermögen (private Vermögensverwaltung), als Geschäftsvermögen Selbständigerwerbender oder in einer Kapitalgesellschaft gehalten werden. Häufig wird eine Liegenschaft jedoch sowohl für geschäftliche als auch für private Zwecke verwendet. Wir haben bei Frau Silvia Ulrich von der AS & T AG Attenhofer Treuhand* über die Zuordnung einer Liegenschaft zum Privat- oder Geschäftsvermögen nachgefragt.
Frau Ulrich, ich beabsichtige ein Gebäude mit einer Praxis für mein Geschäft zu erwerben. Ebenfalls möchte ich im Obergeschoss eine Wohnung für meine Familie einrichten. Wird diese Liegenschaft als Privat- oder Geschäftsvermögen qualifiziert?
Die rechtliche Beurteilung, ob eine Liegenschaft dem Privat- oder Geschäftsvermögen zugeordnet wird, kann von der steuerpflichtigen Person nicht «frei» vorgenommen werden. Gemäss Art. 18 Abs. 2 DBG gelten als Geschäftsvermögen alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbstständigen Erwerbstätigkeit dienen. Demgegenüber gehören die nicht vorwiegend geschäftlich genutzten Objekte zum Privatvermögen, auch wenn sie teilweise geschäftlich benutzt werden. Nach der sogenannten Präponderanz-Methode wird das Gebäude bei einer geschäftlichen Nutzung von mehr als 50% von der Steuerbehörde als Geschäftsliegenschaft qualifiziert. Diese Ausführungen beziehen sich jedoch explizit auf das Geschäftsvermögen Selbständigerwerbender. Wenn hier die geschäftliche Praxisliegenschaft in einer Stockwerkeinheit erworben wird und die privat genutzte Wohnung in einer anderen Stockwerkeinheit, kann die Zuteilung Geschäftsvermögen/Privatvermögen durch den Eigentümer bestimmt werden. Wirtschaftsgüter, die eine juristische Person erwirbt, stellen immer Geschäftsvermögen dar. Bei Ihrem genannten Beispiel müsste in der juristischen Person ein Privatanteil für die Nutzung der privaten Wohnung berücksichtigt werden.
Wird die Grundstückgewinnsteuer nach einem Verkauf sofort fällig?
Nein, die Grundstückgewinnsteuer wird nicht immer sofort fällig. Beispielsweise wird die Grundstückgewinnsteuer bei einer ausschliesslich selbstgenutzten Wohnliegenschaft aufgeschoben, soweit der dabei erzielte Erlös innert angemessener Frist zum Erwerb oder zum Bau einer gleichgenutzten Ersatzliegenschaft in der Schweiz verwendet wird. Ebenfalls wird die Grundstückgewinnsteuer bei einem Eigentumswechsel durch Erbgang, Erbvorbezug oder Schenkung aufgeschoben.
Wie sieht es aus bei der Grundstückgewinnsteuer bei einem Verkauf einer Liegenschaft im Geschäftsvermögen?
Je nach Kanton folgt man bei der Grundstückgewinnsteuer dem monistischen oder dem dualistischen System. Im monistischen System werden bei Selbständigerwerbenden die Grundstückgewinne auf kantonaler Ebene bei der Veräusserung von Liegenschaften des Geschäftsvermögens mit der Grundstückgewinnsteuer erfasst; die wieder eingebrachten Abschreibungen unterliegen der Einkommenssteuer. Beim dualistischen System werden Grundstückgewinne aus dem Verkauf von Geschäftsliegenschaften mit der Einkommenssteuer abgerechnet. Nach Art. 18 DBG erfolgt für Grundstückgewinne des Geschäftsvermögens eine Besteuerung mit der Einkommenssteuer (plus AHV).
Die Differenz zwischen den Anlagekosten und dem massgebenden Einkommenssteuerwert (Buchwert) unterliegt zusammen mit dem übrigen Einkommen der Einkommenssteuer. Aufgrund der Steuerprogression ist daher noch mit einer höheren Steuerlast zu rechnen. Der Veräusserung gleichgestellt ist die Überführung des Geschäftsvermögens in das Privatvermögen. Damit wird verhindert, dass Steuersubstrat verloren geht, da Grundstückgewinne im Privatvermögen beim Bund steuerfrei sind. Bei der Überführung in das Privatvermögen werden die stillen Reserven realisiert, und darauf wird die Einkommenssteuer erhoben. Bei einem Kauf bzw. Verkauf einer Liegenschaft sowie während der Haltedauer gibt es aus steuerrechtlicher Perspektive viele Optimierungsmöglichkeiten. Mit einer frühzeitigen und umfassenden Planung können die Varianten einander gegenübergestellt und mit den Kunden die «steuerlich» attraktivste Lösung gefunden werden. Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Zur Person
Silvia Ulrich, dipl. Expertin in Rechnungslegung und Controlling
AS & T AG Attenhofer Treuhand*
Schlösslistrasse 16a
5408 Ennetbaden
Telefon 056 265 00 72
mail@fmhtreuhand.ch
www.fmhtreuhand.ch
*AS & T AG Attenhofer Treuhand ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Inflation – was tun?
Wir gehen darauf ein, wie wir als Anleger heute mit der Inflationsproblematik umgehen sollen.
Bereits im Herbst 2021 haben wir von Roth Gygax & Partner AG* im Skalpell über dieses Thema geschrieben. Damals war die Welt aber noch eine andere. Der Krieg in der Ukraine war noch nicht ausgebrochen und somit haben auch keine Sanktionen die Preisspirale in Gang gesetzt. Die Inflationsangst bestand damals insbesondere in der enormen Geldmengenausweitung der Nationalbanken. Daher wollten wir dieses Thema nochmals aufnehmen.
Erklären Sie uns bitte kurz, was es mit der Inflation auf sich hat?
Die Inflation beschreibt die prozentuale Veränderung, welche die Konsumenten für den Kauf eines bestimmten Warenkorbs im Vergleich zum Vorjahr bezahlen müssen. Im August 2022 betrug in der Schweiz die Jahresteuerung 3.5 %. Somit mussten die Konsumenten für den besagten Warenkorb 3.5 % mehr bezahlen, als sie dies im August 2021 hätten tun müssen. Die Kaufkraft des erzielten Einkommens und der Ersparnisse hat also abgenommen.
Im internationalen Vergleich ist eine Inflation von 3.5 %, welche die Schweiz aktuell ausweist, recht tief. Ist dies daher kein allzu grosses Problem?
Im Vergleich zum Ausland, wo z.B. im Euroraum die Teuerung im August 9.1 % oder in den USA im Juli 8.5 % betrug, ist dieser Wert recht tief. Trotzdem ist diese Entwicklung alles andere als erfreulich. Auf einem Bankkonto mit CHF 100‘000 beträgt der Kaufkraftverlust CHF 3‘500. Hat ein Kunde ein Guthaben von 1.5 Mio. in der Pensionskasse und verzinst diese mit 2 %, dann beträgt der Kaufkraftverlust CHF 22‘500. Die Kosten durch die Inflation sind daher auch in der Schweiz hoch.
Es ist immer wieder zu hören, dass der publizierte Index nicht die Realität widerspiegelt. So fehlen z. B. die Krankenkassenprämien in diesem Korb. Ist daher der Wertverlust sogar höher als publiziert?
Der Landesindex für Konsumentenpreise (LIK) widerspiegelt die Preisentwicklung eines möglichst umfassenden Warenkorbs. Daher ist nicht jede Person in gleichem Ausmass betroffen. So führen steigende Mietzinsen nur zu einer effektiven Teuerung bei Personen welche Mieter sind und auch tatsächlich umziehen. Die Krankenkassenprämien fehlen effektiv in diesem Index. Erfasst sind jedoch Arzt-, Zahnarzt- und Spitalleistungen sowie Medikamente. Die Krankenkassenprämien steigen aber insbesondere auch wegen dem steigenden Konsum von Gesundheitsgütern. Ein Preisindex zeigt aber nur die Entwicklung der Preise und nicht veränderte Konsumgewohnheiten. Daher fehlen diese Prämien im Index.
Interessant. Und wie kann man sich nun gegen Inflation schützen?
Wie bereits erwähnt werden Waren teurer bei gleichbleibendem Wert des Geldes. Daher drängen sich auch Anlagen in Waren, also Sachwerte, auf. Das sind typischerweise Immobilien und Gold, aber auch Aktien oder Kunstgegenstände gehören dazu. Aktien sind Sachwerte, da dahinter Firmen mit ihren Immobilien, Produktionsanlagen, Patenten, usw. stehen. Nominalwerte sind das Pendant zu Sachwerten und umfassen Obligationen, Bargeld, Kassenscheine usw.
Folglich sollte ich möglichst viel von meinem Vermögen in Sachwerte investieren?
Theoretisch ja. Aber wie immer haben auch Sachwerte nicht nur Vorteile. Die Inflation ist nur ein Kriterium. So schwanken Sachwerte typischerweise stärker im Wert als Nominalwerte. Auch Illiquidität kann je nach Anlageklasse ein Problem darstellen.
Insbesondere Aktien unterliegen starken Schwankungen. Bei Immobilien sind die Zyklen deutlich länger. So hatten wir in der Schweiz in den Neunzigerjahren sinkende Preise und verzeichnen nun bereits seit über 20 Jahren einen Aufwärtstrend. Kürzere Zyklen mit stärkeren Ausschlägen waren in den USA oder in Spanien zu beobachten. Das knappe Angebot in der Schweiz stützt sicher zusätzlich die Preise, so dass die Verwerfungen bei uns grundsätzlich tiefer sind.
Zu Ihrer Frage: Es sollte so viel in Sachwerte investiert werden, wie die Risikofähigkeit und die Risikobereitschaft zulassen.
Erklären Sie das.
Die Risikofähigkeit beschreibt die wirtschaftliche Fähigkeit eines Anlegers Verluste zu tragen. Ausschlaggebend sind die Einkommens- und Vermögenssituation sowie der Anlagehorizont. Die Risikobereitschaft beschreibt die persönliche Bereitschaft eines Anlegers Verluste zu akzeptieren.
Was dominiert?
Ich erlebe meistens, dass die Risikofähigkeit höher ist als die Risikobereitschaft. Sicher hängt das auch damit zusammen, dass der Schweizer Franken traditionell sehr stark und über eine lange Zeit stabil ist. Es ist leicht nachvollziehbar, dass in vielen anderen Ländern die Leute lieber in Sachwerte als in die Landeswährung investieren.
Was empfehlen Sie den Anlegern?
Zuerst muss ein Risikoprofil erstellt werden. Damit wird schriftlich festgehalten, welche Risiken eingegangen werden können. Danach wird das Geld auf verschiedene Töpfe verteilt, wobei sich die Anlageklassen gut ergänzen sollten. Denn jede Anlageklasse hat Vor- und Nachteile. Eine Gesamtbetrachtung ist zentral. Der Aufbau eines Aktienportfolios dient als primärer Inflationsschutz. Dabei ist ein regelmässiger über Jahre zu erfolgender Aufbau einer raschen oder einmaligen Anlage klar Vorzug zu geben. Für den Investor ist es wichtig, dass das Aktienportfolio nicht isoliert betrachtet wird. Hat jemand CHF 200‘000 in Aktien investiert und die Börse taucht um 15 %, wie dies in diesem Jahr der Fall war, dann resultiert ein Verlust von CHF 30‘000. Das ist viel, wird aber relativiert, wenn diese Person daneben noch ein Einfamilienhaus, ein BVG, eine 3a-Lösung und etwas Liquidität hält. Dann beträgt der Verlust plötzlich nur noch 2 % oder 3 %.
Dann bietet sicher auch das selbstbewohnte Wohneigentum oder allenfalls die geerbte Liegenschaft einen guten Inflationsschutz. Zudem kommen vermehrt auch Immobilienanlagen mit Versicherungsmantel auf den Markt. Dies ist insbesondere deshalb sehr spannend, da so die Erträge von der Einkommenssteuer befreit werden, was bei Mieteinahmen zentral ist.
Dank der gestiegenen Zinsen gibt es aber auch wieder gute Anlageprodukte, wo auf einen Teil der Rendite verzichtet wird, dafür wird aber ein gewisser Schutz geboten. Dies kann als Ergänzung zum Aktienportfolio sehr interessant sein.
Zu guter Letzt kann auch Gold einen gewissen Inflationsschutz bieten. Da Gold aber keine laufenden Erträge abwirft, würden wir diese Anlageklasse nicht allzu hoch gewichten. Es gibt also nicht das Rezept, welches vor Inflation schützt. Eine intelligente Zusammensetzung der verschiedenen Anlagen schützt möglichst optimal vor unterschiedlichen Risiken.
Wie wird der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) erhoben?
Das Bundesamt für Statistik BFS erhebt den LIK monatlich. Dazu werden vor Ort, per Telefon, im Internet oder auf dem Korrespondenzweg insgesamt 100‘000 Preise pro Monat in rund 8‘000 Verkaufsstellen erhoben, wobei ca. 5‘200 auf die der Mietpreiserhebung teilnehmenden Vermieter fallen.
Zur Person
Stefan Walther ist Mitglied der Geschäftsleitung der Roth Gygax & Partner AG*.
Roth Gygax & Partner AG*
Moosstrasse 2
3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00
mail@fmhinsurance.ch
www.fmhinsurance.ch
*Von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
All-Risks für Arztpraxen – umfassende moderne Deckung
Das Praxisinventar und die eingesetzten Medizinalgeräte können je nach Fachrichtung rasch einige CHF 100'000 kosten.
Es lohnt sich und ist wichtig, dass Inventar und Geräte auch gegen Beschädigung, Zerstörung und Verlust zu versichern. FMH Services (Insurance) hat deshalb ein umfassendes Deckungspaket entwickelt, um einen optimalen Schutz zu bieten. Herr Roger Ledermann, Mitglied der Geschäftsleitung der Roth Gygax & Partner AG*, war massgeblich an dieser Entwicklung beteiligt. Was diese Lösung alles bietet, wollten wir im Interview erfahren.
Herr Ledermann, warum haben Sie sich für das All-Risks Deckungskonzept entschieden?
Lassen Sie mich zuerst kurz die beiden Konzepte erläutern: Eine herkömmliche Deckung umfasst normalerweise die Risiken Feuer, Elementarschäden, Wasser, Einbruch. Hierbei handelt es sich um die wesentlichen Gefahren bezogen auf die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadenausmass. Zusätzliche Risiken können eingeschlossen werden wie z. B. das Fallenlassen eines Gerätes, Erdbeben usw. Alles, was explizit erwähnt ist, wird versichert.
Eine All-Risks Deckung kehrt diesen Spiess um. Grundsätzlich ist jegliche plötzliche Beschädigung, Zerstörung oder das Abhandenkommen gedeckt. Einzig spezifische Situationen werden ausgeschlossen. Einerseits geht die Deckung so weiter als eine herkömmliche Versicherung. Andererseits gibt es eine Umkehr der Beweislast. Der Versicherer muss daher belegen, weshalb ein Schadenfall unter einen Ausschluss fällt und nicht gedeckt ist.
Das klingt verlockend. Ist es den nicht so, dass über die Ausschlüsse sowieso wichtige Risiken wieder wegbedungen werden?
Nein, diese Meinung vertrete ich nicht. Über unsere All-Risks Deckung lässt sich eigentlich alles versichern, was versichert werden kann und versichert werden soll. Lassen Sie mich die wichtigsten Ausschlüsse aufführen, um dies zu erläutern:
Schäden infolge dauernder voraussehbarer Einflüsse sind nicht gedeckt. Darunter fallen z. B. die Alterung und Abnutzung eines Gerätes. Sie geben mir sicherlich Recht, dass dies nicht im Sinne einer Versicherung sein kann.
Dann sind Schäden ausgeschlossen, für welche ein Hersteller haftet. Ein klassisches Beispiel hierfür ist ein Garantiefall, was mit der Versicherung nur zu einer Doppeldeckung führen würde.
Weiter nicht gedeckt ist eine Veruntreuung oder Betrug durch einen Angestellten oder das eigene Verlieren oder Verlegen eines Gegenstands.
Wie sieht es mit Cyberrisiken aus, sind diese gedeckt?
Nein, diese sind nicht durch die All-Risks Deckung versichert. Cyberrisiken betreffen verschiedene Versicherungslösungen wie die Haftpflichtversicherung, die Sachversicherung oder die Rechtsschutzversicherung. Wir sind der Meinung, dass es sinnvoller ist, dies über eine spezialisierte Police abzudecken, und haben deshalb ein separates, spezialisiertes Angebot entwickelt.
Ist eine All-Risks-Deckung viel teurer als eine herkömmliche Versicherung?
Obwohl eine All-Risks Deckung einen umfassenderen Versicherungsschutz bietet, ist die Prämie äusserst attraktiv. Je nach Höhe der Versicherungssumme und des Umsatzes muss eine All-Risks Deckung gar nicht teurer sein als eine herkömmliche Lösung.
Die Deckung kostet für eine Arztpraxis mit einem Inventar von CHF 130'000 und einem Umsatz von CHF 600'000 rund CHF 550 pro Jahr. Sofern das Erdbebenrisiko sowie innere Schäden ausgeschlossen werden, reduziert sich die Prämie auf rund CHF 430.
Weshalb ist eigentlich der Umsatz relevant?
Nebst den Geräten und dem Inventar profitieren Sie auch von einer Betriebsunterbruchversicherung. Können Sie Ihre Praxis nach einem versicherten Schadenfall beispielsweise einige Wochen nicht öffnen, übernimmt diese Versicherung die Umsatzeinbusse.
Herr Ledermann, können Sie uns zusammenfassend sagen, weshalb Ihre Lösung die richtige ist für angehende Praxisinhaber/innen?
Unsere Rahmenvertragslösungen sind auf die Bedürfnisse der Ärzteschaft optimal abgestimmt und die Prämien sehr attraktiv. Mit über 20 Jahren Erfahrung und durch die Beratung und Begleitung von über 9'000 Ärztinnen und Ärzten kennen wir die herausfordernde Situation einer Praxisgründung oder -übernahme bestens. Zudem profitieren Sie als Genossenschafter/in der FMH Services von exklusiven Konditionen und Rabatten.
Nebst der All-Risks-Deckung erhalten Sie von uns alles, was Sie im Bereich von Versicherung, Vorsorge und Vermögen für sich und Ihre Praxis brauchen. Unsere Spezialisten in der ganzen Schweiz beraten Sie persönlich und umfassend.
Roth Gygax & Partner AG*
Moosstrasse 2
3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00
mail@fmhinsurance.ch
www.fmhinsurance.ch
*Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Beratungsunternehmen.
Bewertung der Benutzerfreundlichkeit von Praxisinformationssystemen
Die Auswahl eines Praxisinformationssystems (PIS) ist eine komplexe Entscheidung. Der Artikel erklärt, was hierbei zu beachten ist.
Zentrale Bedeutung kommt dabei der Bewertung der Benutzerfreundlichkeit zu. Sie bestimmt, in welchem Masse die Ziele einer Praxis unter Einsatz der Software effektiv, effizient und zur Zufriedenheit erreicht werden.
Fehlende Nutzerzentrierung hemmt die Freude am Einsatz der Software
Harzt es an der Mensch-Maschine-Schnittstelle, kann Informationstechnologie (IT) schnell zu Frustration führen. Das belegt eine Beobachtungsstudie an 15'505 Beschäftigten im Gesundheitswesen. Ein Drittel aller Gesundheitsfachpersonen erlebt an drei bis fünf Tagen pro Woche Frustration im Umgang mit IT, was langfristig zu emotionaler Erschöpfung führen kann (Tawfik et al. 2021). Der Evaluation der Benutzerfreundlichkeit kommt damit besondere Bedeutung zu. Doch welche Aspekte gilt es hierbei zu berücksichtigen?
Benutzerfreundlichkeit als grundlegendes Qualitätsmerkmal
Benutzerfreundlichkeit (Usability) bedeutet, dass Software «menschenfreundlich», d.h. einfach und intuitiv, zu bedienen ist und alltägliche Aufgaben mit Leichtigkeit erledigt werden können. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal also. Je besser ein PIS auf die Anforderungen des Alltags zugeschnitten ist und je mehr es sich an den Bedürfnissen der Benutzer orientiert, desto grösser ist auch der damit assoziierte Nutzen.
Praxisziele effektiv, effizient und mit hoher Zufriedenheit erreichen
Die ISO-9241-11 Norm definiert Benutzerfreundlichkeit über «das Ausmass, in dem eine Software von Benutzern verwendet werden kann, um Ziele mit Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit zu erreichen» (Herczeg 2018, s. Abb. 1). Ein PIS (Produkt) weist hohe Benutzerfreundlichkeit auf (Ziele = Ergebnis der Interaktion), wenn die Benutzer (z. B. Ärztin/Arzt, MPA) die Ziele (Dokumentation, Kommunikation, Interaktion) vollständig (Effektivität), mit geringem Aufwand (Effizienz) und mit gutem Ergebnis (Zufriedenheit) erreichen. Benutzerfreundlichkeit ist zudem kontextabhängig. Sie wird beeinflusst vom Setting, in dem die Benutzer arbeiten (Einzelpraxis, Gruppenoder Gemeinschaftspraxis). Sie wird durch die Art der verwendeten Endgeräte (Desktop-, Mobile-Devices), die Umgebung (Behandlungszimmer, Anmeldung), die Aufgabe (z. B. Dokumentation, Labor, Terminierung, Abrechnung) und die Eigenschaften der Benutzer (Motivation, IT-Erfahrung) beeinflusst.
Beteiligung aller relevanten Benutzergruppen an der Evaluation
Die Einflüsse der Kontextfaktoren auf die Benutzerfreundlichkeit von Software weisen darauf hin, dass das Benutzererlebnis stark von einer Übereinstimmung zwischen den Merkmalen der Schnittstelle (User Interface Design) und den jeweiligen Merkmalen der Benutzer im Anwendungskontext (Mensch-Maschine-Interaktion) abhängt. Je nach den Kontextfaktoren kann das Nutzererlebnis bei ein und demselben PIS sehr unterschiedlich ausfallen. Die Ärztin / der Arzt kann in der Behandlungssituation grösste Zufriedenheit erlangen, während die Praxisangestellten Misserfolge beim Erreichen administrativer Ziele erleben. Achten Sie deshalb darauf, dass am Evaluationsprozess möglichst alle Benutzergruppen beteiligt sind.
Konkrete Umsetzungsvorschläge zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit
Bei der Evaluation müssen die Testpersonen potenzielle PIS anhand von Entscheidungskriterien bewerten. Typische Bewertungskriterien zur Beurteilung der Benutzerfreundlichkeit sind die von Nielsen (2003). Sie sind generisch und berücksichtigen die wichtigsten Usability-Aspekte. Erweitert werden können diese durch weitere Akzeptanzkriterien, die speziell für den Praxisbetrieb wichtig sind. Sie können einfach mithilfe des vorgestellten Usability-Frameworks (vgl. Abb. 1) ermittelt werden. Gehen Sie hierzu spezifische Anforderungen des Alltags durch und lassen Sie sich diese im PIS demonstrieren.
- Sichtbarkeit des Systemstatus: PIS gibt Benutzer den Systemstatus an.
- Übereinstimmung zwischen System und realer Welt: PIS «spricht Sprache der Benutzer», nicht mit systemorientierten Begriffen.
- Benutzerkontrolle und Freiheit: Vorgänge lassen sich einfach rückgängig machen. Ausgangszustand kann wiederhergestellt werden.
- Konsistenz und Standards: PIS entspricht fachlichen Standards und bildet diese eindeutig ab.
- Wiedererkennen statt abrufen: Routinemässige Aktionen sind effizient ausführbar und können durch Workflows unterstützt werden.
- Flexibilität und Effizienz der Nutzung: «Abkürzungen», z. B. Tastenkombinationen, beschleunigen die Interaktion. Nutzeransichten vereinfachen die Arbeit.
- Ästhetisches und minimalistisches Design: Ansichten und Dialoge sind übersichtlich und enthalten keine irrelevanten Informationen.
- Fehler erkennen, diagnostizieren und beheben: PIS gibt Warn-/Fehlermeldungen in einfacher Sprache aus und impliziert einen Lösungsvorschlag für ein Problem.
- Fehlervermeidung: Ein intuitives UI verhindert, dass Fehler überhaupt auftreten.
- Hilfe und Dokumentation: Strukturierte Hilfe und Dokumentation sind verfügbar.
Hinter den Vorhang schauen und testen
Die Bewertung kann im Rahmen der Herstellerpräsentationerfolgen. Lenken Sie den Fokus der Präsentation dabei auf Ihre Bedürfnisse und lassen Sie sich Abläufe in der Software zeigen. Setzen Sie zudem Prioritäten bei der Bewertung: von «must have» zu «nice to have». Stellen Sie sich bei der Evaluation die tägliche Arbeit mit der Software vor. Bewerten Sie Kriterien z. B. auf einer Skala von 0 bis 10. Fordern Sie Ihre Mitarbeitenden auf, Fragen zu stellen und für Sie relevante Kriterien zu überprüfen. Fragen Sie auch nach einer Demo. Praktisch jede kommerzielle Software hat heute ein Demonstrationsoder Evaluationspaket. Fragen Sie kritisch nach, wenn dies bei einem PIS-Anbieter nicht möglich sein sollte.
Unterstützung durch healthinal
Falls Sie sich bei der PIS-Evaluation unterstützen lassen wollen, stehen wir Ihnen mit unserem bewährten PIS Evaluationsprozess, einem entsprechenden Methodenkoffer und weitreichender Erfahrung zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.
Quellenverzeichnis
1. Herczeg M. (2018). Software-Ergonomie: Theorien, Modelle und Kriterien für gebrauchstaugliche interaktive Computersysteme. 4. Auflage, de Gruyter
2. Nielsen J. (2003). Usability 101: introduction to usability. 2003
3. Tawfik DS, et al. (2021). Frustration With Technology and its Relation to Emotional Exhaustion Among Health Care Workers: Cross-sectional Observational Study. J Med Internet Res. 2021 Jul 6;23(7):e26817
Zur Person
Jakob Tiebel, Praxisberater
healthinal GmbH
Neue Jonastrasse 59
8640 Rapperswil
Telefon 055 534 69 11
jakob.tiebel@healthinal.com
www.healthinal.com
Datenschutz ernst nehmen und Vertrauen schaffen
Da die Konsequenzen von Datenverlust und -manipulation besonders im Gesundheitsbereich gravierend sein können, sind Sicherheitsmassnahmen auf allen Ebenen erforderlich.
Die Digitalisierung schreitet auch im Gesundheitswesen unaufhaltsam voran und dies mit allen Vor- und Nachteilen. Abläufe können effizienter gestaltet und somit beschleunigt werden. Digitale Hilfsmittel sind auch in Spitälern und Arztpraxen kaum noch wegzudenken. Doch mit der zunehmenden Digitalisierung vergrössert sich auch die potenzielle Angriffsfläche.
Daten über die Gesundheit von Personen gehören zu den «besonders schützenswerten Personendaten» und verlangen dementsprechend einen sehr guten Schutz. Dabei gilt es, solche Daten vor unbefugten Veränderungen, Zerstörung und Missbrauch zu schützen. Falsche oder nicht verfügbare Informationen können gravierende Konsequenzen haben und die Gesundheit, im schlimmsten Fall sogar Leben gefährden[1].
Sicherheitsmassnahmen auf allen Ebenen: Verhalten, Technik und Organisation
Erst mit einem integralen Ansatz für den Schutz sensibler Gesundheitsdaten kann ein möglichst umfassender Schutz erzielt werden. Dieser Ansatz sieht vor, dass dem Thema auf verschiedenen Ebenen Rechnung getragen wird. Sicherheitsmassnahmen lassen sich dabei in drei Kategorien einteilen: verhaltensbezogen, organisatorisch und technisch.
Zu den verhaltensbezogenen Massnahmen gehört beispielsweise die Verwendung von langen komplexen Passwörtern. Damit diese nicht auswendig gelernt werden müssen, empfiehlt sich die Verwendung eines Passwort-Safes. Mit einem solchen Programm können Passwörter einfach gespeichert und sicher aufbewahrt werden. Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einsatz der Zwei-Faktor-Authentisierung, wobei sich der Anwender neben dem Passwort mit einem zweiten Faktor anmelden muss. Mögliche zweite Faktoren bieten beispielsweise Authentisierungs-Apps (wie die HIN Authenticator App) oder eine hinterlegte Identitätsdatei, wie dies beispielsweise im HIN Client der Fall ist. Für den Fall, dass ein Passwort durch unbefugte Dritte gehackt wird, bleibt ihnen der Zugang auf das betreffende Konto verwehrt, da ihnen der zweite Faktor fehlt. Neben dem Schutz von persönlichen Konten ist es wichtig, sensible Daten immer verschlüsselt zu übermitteln (beispielsweise mit HIN Mail). Unverschlüsselte E-Mails bringen erhebliche Gefahren mit sich, da der Inhalt der Nachricht von unbefugten Dritten abgefangen und eingesehen werden können. Die Vertraulichkeit einer unverschlüsselten E-Mail wird folglich oft mit jener einer Postkarte verglichen.
Zu den wichtigsten technischen Massnahmen gehört unter anderem, dass alle IT-Systeme immer auf dem neusten Stand gehalten werden. Mithilfe von regelmässigen und sicher aufbewahrten Backups können im Falle eines erfolgreichen Cyberangriffes verlorene Daten wieder hergestellt werden. Die Wichtigkeit regelmässiger Backups hat sich beispielsweise gezeigt, als die Hirslanden-Gruppe im Herbst 2020 Opfer eines Verschlüsslungstrojaners wurde[2]. Die verschlüsselten Daten konnten dank einem Backup wieder hergestellt werden und die Patientenversorgung war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.
Auch organisatorische Massnahmen können dabei helfen, den Schutz sensibler Daten massiv zu erhöhen. Durch sicherheitsrelevante Vorgaben und kontrollierte Abläufe können Risiken minimiert werden. Dazu gehört beispielsweise die Bestimmung von Verantwortlichkeiten oder das Einschränken von Berechtigungen. Vorgesetzte, die mit gutem Beispiel vorangehen, können Mitarbeitende motivieren, das Thema Datenschutz ernst zu nehmen. Ergänzt durch eine regelmässige Schulung der Mitarbeitenden zum Thema Datenschutz und ITSicherheit entsteht eine erhöhte Sensibilisierung, welche sich langfristig positiv auf das Verhalten im Umgang mit sensiblen Daten auswirkt.
Durch gezielte Schulung das Bewusstsein für Gefahren schärfen
Für den Schutz von sensiblen Daten sind technische Massnahmen wichtig, doch ein ebenso wichtiger Faktor ist das menschliche Verhalten. Wer sich den Gefahren der Cyberkriminalität bewusst ist, kann diesen mit mehr Sicherheit begegnen und unter Umständen sogar dort eingreifen, wo die Technik versagt. Um Mitarbeitende für das Thema Datensicherheit zu sensibilisieren, empfiehlt sich eine regelmässige und gezielte Schulung. Im Fokus soll dabei nicht die reine Informationsvermittlung stehen, sondern die Schaffung eines langfristigen Bewusstseins für mögliche Gefahren. Eine Datenschutz-Schulung legt eine solide Basis dafür, dass sich jede und jeder ihrer oder seiner Verantwortung bewusst ist und diese im Arbeitsalltag wahrnimmt.
Auch das Bundesamt für Justiz (BJ) weist in seinem erläuternden Bericht zum neuen Datenschutzgesetz (nDSG) ausdrücklich auf die Relevanz von Schulungen und Beratungen hin[3]. Denn aus Sicht des Bundesrates hängen die Umsetzung und Wirksamkeit der Datensicherheit insbesondere auch davon ab, ob die involvierten Personen vorgesehene Massnahmen in Bezug auf IT-Sicherheit und Datenschutz korrekt anwenden. So können durch Schulungen und Beratungen die Risiken von Datensicherheitsverletzungen minimiert werden, beispielsweise durch den bewussten Umgang mit potenziell gefährlichen E-Mail-Anhängen oder Links.
Datenschutz ernst nehmen und Vertrauen schaffen
Patienten und Patientinnen dürfen von ihren Behandelnden eine sorgfältige Behandlung erwarten und somit ein rechtmässiges Verhalten bezüglich des Umgangs mit Patientendaten. Gesundheitsfachpersonen sind verpfl ichtet, das Patientengeheimnis zu wahren und sie unterstehen dem Datenschutzgesetz. Eine qualitativ hochwertige Behandlung der Patienten bedingt somit unter anderem, dass dem Datenschutz jederzeit Rechnung getragen wird. Ärzte und Ärztinnen, die ihre Verantwortung für den Datenschutz wahrnehmen und dies ihren Patienten gegenüber transparent machen (beispielsweise mit dem HIN Label), tragen dazu bei, das Vertrauensband zwischen Arzt und Patienten zu stärken.
Quellenverzeichnis
[1] Nationales Zentrum für Cybersicherheit NCSC, Halbjahresbericht 2020/2, 11.05.2021, https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/dokumentation/berichte/lageberichte/halbjahresbericht-2020-2.html
[2] Neue Zürcher Zeitung, «Cyberangriff auf die Hirslanden-Gruppe: Die Spitäler sind wegen der Pandemie besonders anfällig für Erpressungen», 25.11.2020, https://www.nzz.ch/schweiz/cyberangriff-auf-die-hirslanden-gruppe-die-spitaeler-sind-wegen-der-pandemie-besonders-anfaellig-fuer-erpressungen-ld.1587386
[3] Bundesamt für Justiz (BJ), «Totalrevision der Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz», Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, 23.06.2021, https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/staat/gesetzgebung/datenschutzstaerkung/vn-ber-d.pdf.download.pdf/vn-ber-d.pdf
Zur Person
Jona Karg, Leiter Schulungswesen
Health Info Net AG
Seidenstrasse 4
8304 Wallisellen
Telefon 0848 830 740
jona.karg@hin.ch
www.hin.ch
Patienten behandeln ohne Angst vor Haftungsrisiken
Wie sich dieser Schutz am besten organisieren lässt und auf welche Details man Acht geben sollte, finden Sie in den folgenden Zeilen.
Die Roth Gygax & Partner AG* – Vertrauenspartner FMH Services (Insurance) – berät über 9‘000 Ärztinnen und Ärzte und betreut ein Portefeuille von rund 3‘000 Berufshaftpflichtversicherungen. Damit zählt sie zu den grössten unabhängigen Beratern von Medizinalpersonen in der Schweiz. Roger Ledermann sagt, eine umfassende Berufshaftpflichtdeckung sorgt dafür, dass sich Ärzte ohne Angst vor Haftungsrisiken ihrem Beruf widmen können.
Herr Ledermann, welchen Fehler darf man beim Abschluss einer Ärzte-Haftpflichtversicherung nie machen?
Ich denke das Wichtigste ist, die Tätigkeit einer Ärztin oder eines Arztes bei der Ausarbeitung einer Versicherungsdeckung so exakt wie möglich zu erfassen, damit keine Deckungslücken entstehen können. Die Versicherungsgesellschaften wenden heutzutage eine viel detailliertere Risikoeinstufung an als früher. Darum muss oft viel präziser nachgefragt werden, welche Behandlungsmethoden angeboten werden und welchen
Anteil diese an der gesamthaften Tätigkeit ausmachen. Unser Grundsatz lautet hier, sobald eine Tätigkeit für eine Fachrichtung speziell ist, sollte sie besser vorgängig deklariert werden.
Weshalb ist die Tätigkeit für die Versicherung so wichtig?
Je nach Tätigkeit ist das Haftungsrisiko und mögliche Schadensummen unterschiedlich hoch. Die Versicherungsgesellschaften wenden daher unterschiedliche Tarife an, um ihrer Kundschaft risikogerechte Prämien anzubieten. Mit dieser Einstufung werden jedoch auch nur die vorgesehenen Tätigkeiten versichert. Lassen Sie mich dies anhand eines Beispiels erläutern:
Für Gynäkologinnen und Gynäkologen gibt es heute in der Regel drei Tarife: Gynäkologie mit Geburtshilfe, Gynäkologie mit Schwangerschaftsbegleitung aber ohne Geburten oder Operationen, Gynäkologie ohne
Geburtshilfe. Die Abgrenzung zwischen diesen Stufen ist nicht immer leicht. So kann es sein, dass ein Arzt beispielsweise Entbindungen in einer Anstellung an einem Spital vornimmt, vorbereitende Untersuchungen jedoch in der eigenen Praxis tätigt. Kommt es während der Geburt zu Komplikationen, ist die Schuldfrage und die Haftung oft nicht klar.
In solchen Beispielen hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Schadenansprüche stark angestiegen sind. Welche Versicherungssumme empfehlen Sie aktuell?
Wir empfehlen in den meisten Fällen eine Garantiesumme von 10 Mio. Je nach Fachrichtung oder wenn sich mehrere Ärzte zusammenschliessen und über eine Police versichert werden, können auch höhere Summen sinnvoll sein. Diese Summe ist in unseren Rahmenverträgen übrigens in Form einer Jahres-Zweifach-Garantie versichert. Das heisst, ein einzelner Schadenfall ist bis höchstens 10 Mio. gedeckt, alle Schadenfälle eines Jahres zusammengerechnet jedoch bis zu 20 Mio.
Und was für einen Selbstbehalt vereinbaren Sie jeweils?
Dies kommt ganz auf die damit verbundene Prämieneinsparung an. Als Faustregel bewährt sich für chirurgisch tätige Fachrichtungen ein Selbstbehalt von CHF 5‘000 sowie für nicht chirurgisch tätige Ärztinnen und Ärzte CHF 1‘000.
Die von Ihnen angebotenen Berufshaftpflichtversicherungen sind Teil von Rahmenverträgen. Was bedeutet dies und welche Vorteile bietet dies der Kundschaft?
Über 9‘000 Ärztinnen und Ärzte vertrauen bereits auf unsere Beratung und es werden täglich mehr. Ihr Vertrauen in uns ermöglicht es, bei den Versicherungsgesellschaften spezielle Konditionen auszuhandeln. Im Sinne einer Einkaufsgenossenschaft handeln wir so vorteilhafte Rahmenverträge aus, wodurch unsere Kundschaft von einem umfassenden Deckungskonzept zu einer attraktiven Prämie profitiert. Auch der Versicherer profitiert von effizienten Arbeitsabläufen, ausgelagerten Tätigkeiten wie zum Beispiel einer professionellen Risikoeinschätzung, usw.
Dank unseren Rahmenverträgen ist es in der Regel so, dass unsere Kundinnen und Kunden über uns weniger für die gleiche Deckung bezahlen, als wenn sie diese direkt bei der Gesellschaft einkaufen würden.
Welche Anforderungen setzen Sie an Ihre Rahmenvertragspartner?
Nebst dem umfassenden Deckungs-Wording und der attraktiven Prämie ist uns wichtig, einen verlässlichen Partner als Gegenüber zu haben. Gerade in der Berufshaftpflichtversicherung ist dies zentral. Daher haben wir beispielsweise vorausgesetzt, dass unsere Partnergesellschaften über einen auf Medizinalrecht spezialisierten Schadendienst verfügen, damit im Falle eines Falles unsere Kundschaft die bestmögliche Unterstützung erhält.
Ihr Angebot wird nun mit einem dritten Rahmenvertragspartner ergänzt. Was können Sie uns dazu erzählen?
Wir pflegen eine langjährige Partnerschaft mit der AXA und der Allianz, welche zu den grössten Anbietern von Ärztehaftpflichtversicherungen in der Schweiz gehören. Unsere Kundschaft und wir sind sehr glücklich über diese ausgezeichnete, gut laufende Zusammenarbeit.
Wir freuen uns nun sehr, dass mit der Zürich Versicherung eine dritte Gesellschaft dazustösst. Die Zürich ist aktuell der grösste Anbieter von Spitalhaftpflichtversicherungen und verfügt dadurch über ein hervorragendes Know-how in der Behandlung von Schadenfällen, wovon unsere Kundschaft nur profitieren kann.
Am 1. Januar 2022 tritt das teilrevidierte VVG in Kraft. Man spricht davon, dass zahlreiche Änderungen die Haftpflichtbranche betreffen. Inwiefern ist die Ärztehaftpflicht davon betroffen?
Der wichtigste Punkt hier ist sicherlich das allgemeine direkte Forderungsrecht, welches den Geschädigten neu zusteht. Dies kennt man beispielsweise bereits in der Autoversicherung, wodurch ein Geschädigter seine Forderung direkt beim Haftpflichtversicherer des Schuldigen stellen kann. Diese Möglichkeit steht nun ab dem nächsten Jahr auch einem geschädigten Patienten zu. In der Praxis schaltet heute ein Arzt oder eine Ärztin sowieso umgehend die Haftpflichtversicherung ein, welche anschliessend die Verhandlungen mit der Gegenpartei führt. Diese Änderung wird daher meines Erachtens im Alltag kaum zu einem anderen Vorgehen führen.
Schlussfrage: Herr Ledermann, warum soll sich ein Arzt bei Ihnen versichern?
Ärztespezifische Beratung und umfassende Deckung zu einem attraktiven Preis. Wer möchte das nicht? Durch unsere Fokussierung auf die Medizinalbranche kennen wir die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden bestens. Wir beraten Sie in allen Versicherungs-, Vorsorge- und Vermögensfragen umfassend und unabhängig. Dank Rahmenverträgen profitieren Sie zusätzlich von exklusiven Versicherungslösungen mit attraktiven Prämienrabatten.
Zur Person
Roger Ledermann ist Mitglied der Geschäftsleitung der Roth Gygax & Partner AG*.
Attraktive Hypothekarbörse für Ärzte
Die Roth Gygax & Partner AG* lanciert ein neues Angebot für Hypotheken. Das System funktioniert wie eine Börse. Wir wollten mehr dazu wissen und haben bei Sergio Kaufmann nachgefragt.
Marketing Check-up für Gesundheitsanbieter
Welche Anforderungen sollten Marketing und Kommunikation erfüllen, welche Regeln müssen eingehalten werden?
Marketing und Kommunikation für Gesundheitsanbieter gewinnen an Bedeutung. Konkurrenz- und Kostendruck, digitaler Wandel, veränderte Erwartungen von Patientinnen und Patienten und das zuweilen unter Druck stehende Image der Ärzteschaft bedingen kompetenzvermittelnde und vertrauensbildende Massnahmen. Ärztinnen und Ärzte sind zunehmend unternehmerisch gefordert. Von sich ändernden sozialen Normen und von Patienten, die sich wie Kunden verhalten.
Dr. Meier, Facharzt für Chirurgie, ist nicht gleich Dr. Müller, Facharzt für Chirurgie. Wie die beiden, ihre Leistungen und ihre Praxen wahrgenommen werden, objektiv wie subjektiv, rational wie emotional, wird im Marketing mit dem Begriff «Image» umschrieben. Je authentischer, differenzierter und positiver die Wahrnehmung von Dr. Meier oder Dr. Müller ist, desto stärker ist das jeweilige «Image».
Arzt-Patienten-Beziehung im Wandel
Sie als Ärztin oder Arzt mögen protestieren. Sie sind Gesundheitsversorger, nicht Anbieter irgendwelcher Dienstleistungen. Image, Marketing? Nichts für Sie.
Doch das Zeitalter der mündigen Patientinnen und Patienten und der digitalen Veränderungen ist längst angebrochen. Professionelles Gesundheitsmarketing stellt Weichen für die Zukunft. Welche Anforderungensollten Marketing und Kommunikation erfüllen, welche Regeln müssen eingehalten werden? Und wie lassen sich die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und die Möglichkeiten der eigenen Praxis oder Klinik in Einklang bringen? Wir zeigen auf, wie man zum Nutzen der Patienten und der Ärzteschaft eine Praxis, ein Gesundheitszentrum oder eine Klinik wirksam und unverwechselbar im Gesundheitswesen positionieren kann.
Der Arzt hat das Sagen. Der Patient auch.
Marketing und «ärztliche Berufsethik» sind heute längst kein Widerspruch mehr. So wie Gesellschaft, Wirtschaft, Technologie und Medizin im Wandel stehen, verändert sich auch das Anforderungsprofil der zeitgemässen Arzt-Patienten-Beziehung.
Ob jung oder alt, Patienten sind informierter, mündigerund anspruchsvoller und werden es künftig noch stärker sein. Sie informieren sich über Gesundheitsanbieter und deren Angebote, prüfen diese kritisch und besprechen ihre Rechercheergebnisse in Foren. Sie wollen sich am gesamten Behandlungsprozess beteiligen: von der Prävention bis zur Nachsorge. Sie entscheiden mit, wem sie sich anvertrauen, aber auch, welche Kompetenzen und Leistungen für sie aus medizinischer und emotionaler Sicht wichtig sind. Neue Technologien helfen ihnen dabei, ihre Krankheit, ihre Gesundheit, ihre psychologischen und physiologischen Bedürfnisse besser zu verstehen.
Oft geht es dabei nicht einmal darum, eine Krankheit zu heilen oder Leiden zu lindern. Die Informationen dienen auch dazu, die Gesundheit zu fördern, zu bewahren, das Wohlbefinden zu verbessern und Potenziale zu erweitern.
Ärztinnen und Ärzte in der Zwickmühle
Weiter setzt der Bund auf mehr Wettbewerb, damit die Gesundheitskosten sinken. Stationäre Leistungen werden in den ambulanten Bereich verschoben. Neue Gesundheitszentren werben um Patientinnen und Patienten. Die Tendenz zur Deregulierung und Digitalisierung ist augenfällig.
Als Gesundheitsanbieter gilt es nun stärker denn je, sich mittels eines differenzierten Verständnisses für die zukünftigen Gesundheitsbedürfnisse klar zu positionieren und über die eigene Haltung sowie die spezifischen Kompetenzen sachgerecht zu berichten. Dies schafft Vertrauen. Getreu dem alten Motto «Tue Gutes und sprich darüber».
Kommunikation, die Ärzte und Patienten verbindet
Hier kommt das Marketing ins Spiel. Es ergänzt die ärztlichen Kernaufgaben der medizinischen Untersuchung, Diagnose und Behandlung um den Aspekt der patientenorientierten und unternehmerischen Praxisführung.
Am Anfang steht dabei die professionelle Marktanalyse. Ihr folgt die unternehmerische Strategieentwicklung. Sie berücksichtigt die Veränderungen des Gesundheitsmarktes, die Zentralisierungs- und Konsolidierungstendenzen, neue Versorgungskonzepteund Geschäftsmodelle und die gewandelten gesellschaftlichen Bedürfnisse.
Dann werden die gewonnenen Informationen kritisch geprüft, nach eigenen Wünschen und Möglichkeiten umgesetzt und die Botschaften ausgesendet: auf denjenigen Kanälen, welche die Zielgruppen am besten erreichen, und in der Sprache, die diese am besten verstehen. Lassen Sie sich auf eine Kommunikation mit Ihren Patientinnen und Patienten ein.
Beim ärztlichen Marketing geht es letztlich um den vertrauensbildenden Dialog zwischen «werbenden» Ärzten und informationssuchenden Patienten. Es geht um eine Kommunikation, die Ärzte und Patienten zusammenbringen soll.
Definieren Sie sich: Es gibt keine Nicht-Kommunikation
Auch wenn so mancher Praxisinhaberin und so manchem Praxisinhaber die Zeit fehlt, sich mit Marketing zu befassen: Die Image-Bildung geschieht dennoch. Oder wie es Paul Watzlawick so treffend ausgedrückt hat: «Man kann nicht nicht kommunizieren.» Zielführender für die Bildung der gewünschten Positionierung und Aussenwirkung ist es, wenn Gesundheitsanbieter entsprechend ihren Rahmenbedingungen und ihren Zielen eine für sie geeignete Marketing- und Kommunikationsstrategie entwickeln.
In einem ersten Schritt kann ein strukturierter Fragenkatalog helfen, sich über die eigenen Stärken und Qualitäten klar zu werden (Abb. 1). Wofür stehen Sie als Ärztin und wofür steht Ihre Praxis? Vielleicht als Ärztin, die mit neuesten Technologien in einer modernen Praxis arbeitet? Oder als jemand, der gerne ältere Patienten mit besonderer Empathie begleitet? Oder legt Ihr Praxisteam den Fokus auf die ergänzenden Möglichkeiten der komplementären Medizin? Fragen Sie sich, ob es weitere emotionale, soziale und situative Faktoren in Ihrer Praxis gibt, die Sie differenzieren: Was machen Sie aus Patientensicht anders, zeitgemässer? Dabei geht es nicht nur um die medizinischen Leistungen, sondern gerade auch um unterstützende Aspekte wie beispielsweise besonders kurze Warte- und lange Öffnungszeiten, telemedizinische und komplementärmedizinische Angebote oder die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte freundlich und verständlich zu erklären.
Sind diese Fragen beantwortet, kann man sich unterBerücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen der ärztlichen Kommunikationsplanung, den konkreten Inhalten und der Gestaltung widmen.
Welche Informationen für wen, das ist die Frage
Überlegen Sie sich genau, welche Kernbotschaften Sie welchen Anspruchsgruppen vermitteln möchten, welche Informationen Patientinnen, Patienten, Angehörige und Zuweiser suchen und wie Sie diese Informationen am besten einfach zugänglich machen und visuell darstellen.
Die rechtlichen Grundlagen sind klar
Die rechtlichen Grundlagen ärztlicher Werbung sollen insbesondere den Patientenschutz gewährleisten und eine Kommerzialisierung des Arztberufs verhindern, sodass Patienten nicht unter-, über- und fehlversorgt werden.
Die Zulässigkeit von Gesundheitswerbung beurteilt sich nach verschiedenen rechtlichen Grundlagen:
- dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Gesetz gegen unlauteres Verhalten oder Geschäftsgebaren); betrifft Spitäler, Kliniken und ähnliche Einrichtungen des Gesundheitswesens
- den Vorschriften des Medizinalberufegesetzes (Art. 40 lit. d MedBG); betrifft selbstständig tätige Ärzte
- den kantonalen Gesundheitsgesetzen
- der Standesordnung der FMH, sie betrifft FMH-Mitglieder
- den FMH-Richtlinien (Anhang 2 der FMH-Standesordnung)
Die Konkretisierung der rechtlichen Grundlagen erfolgt dann vor allem durch die kantonalen Ärztegesellschaften und die kantonalen Richtlinien der Gesundheitsdirektion.
Man darf mehr kommunizieren, als man denkt
Das Medizinalberufegesetz, die Standesordnung der FMH sowie der Anhang zur Standesordnung lassen Information und Werbung grundsätzlich zu, sofern sie:
- sachlich und objektiv ist,
- dem öffentlichen Bedürfnis entspricht,
- weder irreführend noch aufdringlich ist,
- nicht der Selbstanpreisung der eigenen Person dient,
- die eigene ärztliche Tätigkeit nicht in aufdringlicher Weise darstellt,
- nicht darauf abzielt, die Patientinnen und Patienten zu medizinischen Eingriffen zu verleiten, deren sie objektiv nicht bedürfen,
- das Ansehen des Arztberufs nicht beeinträchtigen.
Damit unterscheiden sich die rechtlichen Grundlagen im Gesundheitsbereich kaum von denen anderer Branchen, denn irreführende Werbung, unlautere geschäftliche Handlungen und die spürbare Beeinträchtigung der Interessen von Mitbewerbern, Kunden oder sonstigen Marktteilnehmern sind auch dort rechtswidrig.
Kommunikationsplanung zieht sich off- und online durch
Die wirksame ärztliche Kommunikation ist sachlich, authentisch und konsistent. Sie richtet sich direkt an ihre Zielgruppen und deren Bedürfnisse und soll möglichst gleichzeitig auf verschiedenen Kanälen online und offline erscheinen. Wenn die Kommunikation den Betrachter zudem noch belohnt, weil sie nicht nur informativ, sondern auch noch inspirierend und ansprechend ist – umso besser.
Das gesamte Patientenerlebnis, alles, was von einer Praxis oder einer Klinik wahrgenommen wird, von der Telefonansprache, der Kommunikation am Empfang über die Praxisgestaltung bis hin zur ärztlichen Behandlung, ist letztlich entscheidend für das Image der Praxis und für die emotionale Bindung, die zwischen Patient und Arzt entsteht. Nicht nur die medizinische Leistungsqualität, sondern vor allem auch Aspekte wie Empathie, zeitliche Verfügbarkeit oder geteilte Werte führen zu Aufmerksamkeit und fördern das Vertrauen und die Patientenzufriedenheit.
Fünf Medien für einen starken Auftritt
Bei der Kommunikationsplanung für Arztpraxen werden fünf Arten von Medien oder Werbeträgern unterschieden, die je nach Situationen, Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten kombiniert werden:
- Digitale Medien
- Printmedien
- Medien der Aussenwerbung
- Medien der Direktwerbung
- Live-Kommunikation
So können Sie beispielsweise eine Praxiseröffnung mit einer suchmaschinenoptimierten Website, Anzeigen in Amtsblättern und einem Mailing zuhanden der Kollegen und Zuweiser einleiten. Sie können aber auch zusätzlich mit Google AdWords und gezieltem Suchmaschinenmarketing die Eröffnungsphase begleiten. Auch Live-Kommunikation in Form von Publikumsvorträgen hat immer noch einen grossen Stellenwert.
Die Website: Dreh- und Angelpunkt
Eine Praxiswebsite soll primär der Information der Patienten, Angehörigen und Zuweiser dienen und es diesen erleichtern, die für sie geeignete Ärztin zu finden. Natürlich ist das Ziel jedes Website-Inhabers, dass er möglichst hoch im Google Ranking gelistet wird. Über 200 Parameter bestimmten das Ranking Google. Die Details des Google Algorithmus sind unbekannt, aber eines ist klar: «Content is king», d. h., interessanter und sachgerechter Text wird belohnt. Je relevanter die Inhalte für die Zuweiser und Patienten und ihre Suchkriterien, desto höher erscheint die Website im Google Ranking. Andere Faktoren, die das Google Ranking beeinflussen, sind:
die umfassende Darstellung des Angebots wie:
- Sprechstunden, Untersuchungen und Behandlungen
- Praxiseinrichtungen
- Zusammenarbeitsformen und Zusammenarbeitspartner
- zusätzliche Leistungsbereiche wie komplementäre Medizin
das Team mit Namen und akademischen Titeln sowie:
- Facharzttitel FMH bzw. «Praktischer Arzt / Praktische Ärztin» oder «Diplomierter Arzt / Diplomierte Ärztin» gem. Weiterbildungsordnung
- absolvierte Weiterbildungen
- Mitgliedschaften
- gesprochene Sprachen
- Zertifizierungen
- Öffnungszeiten, Kontaktangaben, Anfahrt
- Praxisrundgang
- Informationen über den Praxisablauf
- Aktuelle Informationen (Blog, Newsletter)
- Telemedizinische Leistungen wie Online-Termine oder e-Rezepte
- Offene Stellen
- Glossar medizinischer Begriffe
- Fragen und Antworten
- Impressum
- Datenschutzhinweise
- Verlinkung mit Ärzteverzeichnissen und Bewertungsplattformen
- Verlinkung mit Zusammenarbeitspartnern
Wer Online-Medien in der Praxis professionell nutzen will, muss bei der digitalen Kommunikation gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen. Dank spezieller Verschlüsselungstechnologien können Patientendaten (Einweisungszeugnisse, Befunde, Austrittsberichte etc.) bequem und datenschutzkonform via E-Mail oder Messenger übermittelt werden, ohne dass sie von Dritten eingesehen werden können.
Social Media ja, aber aufgepasst
Social Media wie Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, YouTube oder Instagram können individuell und den Bedu¨rfnissen der Patienten entsprechend thematisch relevant eingesetzt werden. Im Umgang mit sozialen Medien ist besondere Vorsicht geboten bei der persönlichen Meinungsäusserung, bei vertraulichen Informationen und bei Bildern sowie privaten Aussagen zu Gesundheitsfragen. Dies gilt insbesondere, wenn diese nicht von der Ärzteschaft selber formuliert und gepostet wurden, aber von der Leserinsolchermassen interpretiert werden können. Um Vorfälle mit juristischen Konsequenzen zu vermeiden, sollten Diagnosen und Behandlungen nie via Social Media vermittelt oder kommentiert werden.
Publireportagen in Printmedien neu erlaubt
Bei Printmedien wie Fachzeitschriften, Zeitungen, Geschäftsdrucksachen oder Praxisbroschüren gelten die gleichen Bedingungen bezüglich zulässiger Inhalte wie im Online-Bereich. Bei einer Praxisgründung oder Änderungen im Leistungsangebot dürfen Anzeigen zur Information der lokalen Bevölkerung offline und online geschaltet werden. Kolleginnen und Kollegen dürfen mit einem Rundschreiben informiert werden; die breite Bevölkerung jedoch nicht. Publireportagen sind neuerdings auch für die ambulant tätigen Ärzte gestattet.
Fazit: Die Richtung ist vorgezeichnet
Die Beziehung zwischen Patienten und Ärzten ähnelt heutzutage zunehmend einer klassischen Kunden-Dienstleister-Beziehung. Daher dürfen und sollen Leistungen und Kompetenzen von Ärzten, Praxen und Kliniken gezielt – sachlich, informativ und ansprechend – im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten professionell kommuniziert werden. Eine vertrauensbildende Marketingstrategie und Kommunikationsplanung, die unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Praxisinhaber und der Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten die unterschiedlichen Anforderungen kombiniert, ermöglicht einen Gewinn für beide Seiten.
Der Lumina Health Brandingprozess©
10 Fragen zum ärztlichen Marketing
- Wie entwickelt sich das für Sie relevante Gesundheitsmarktumfeld in den kommenden fünf Jahren?
- Welches sind Ihre wichtigsten Kunden- bzw. Patientensegmente und welche Bedürfnisse haben diese heute und zukünftig, rational und emotional?
- Welches sind Ihre Leistungen und welchen funktionalen und emotionalen Nutzen erbringen diese für die Patientinnen und Patienten?
- Welches ist Ihre Unternehmensvision für das Jahr 2025?
- Wie sollen Sie und Ihr Angebot von den Patienten zukünftig erfahren und beschrieben werden?
- Wer sind Ihre wichtigsten Mitbewerber und wie stehen Sie und Ihre Praxis oder Klinik im Vergleich dazu?
- Welches sind aus Patienten- und Zuweisersicht Ihre Vorzüge?
- Welches sind mögliche Schwächen oder Risiken?
- Auf welchen Kanälen kommunizieren Sie heute und zukünftig effektiv mit Ihren Zielgruppen?
- Wie erfahren Ihre Zielgruppen von Ihrer Praxis, Ihren Kompetenzen und Ihrer Haltung?
Zur Person
Tarja Zingg, Geschäftsführerin, Dr. oec. publ., Bachelor Design and Visual Communication
Lumina Health, Agentur für Gesundheitsmarketing
Wolfbachstrasse 1
8032 Zürich
Telefon 043 497 98 66
tarja.zingg@lumina-health.ch
www.lumina-health.ch
Vorgehen zur Auswahl eines Praxisinformationssystem
Haben Sie bereits Erfahrung mit einem bestehenden Praxisinformationssystem oder möchten Sie Ihre klassische Papierakte endlich digitalisieren?
Unabhängig davon, ist die Evaluation eines neuen Systems aufwändig und nur schwer in den Behandlungsalltag zu integrieren.
Viele verschiedene Systeme, unterschiedliche Preismodelle, individuelle Anforderungen und diverse weitere variable Faktoren erschweren die Entscheidung. Trotzdem will dies wohlüberlegt sein, da das gewählte System grossen Einfluss auf Ihre tagtägliche Arbeit, Prozesse, die Mitarbeiterzufriedenheit und die Kostenstruktur hat. Wenn Sie sich entschieden und die Lösung eingeführt haben, machen Sie wenn möglich keinen erneuten Wechsel, da bei einem Umstieg wieder erhebliche Mehraufwände und -kosten entstehen. Gerade deswegen lohnt es sich, für den Prozess genügend Zeit einzuplanen, um die folgenden Schritte strukturiert zu bearbeiten. So stellen Sie sicher, dass Sie von Beginn an die für Sie richtige Entscheidung treffen und profitieren von den vielen Vorzügen, mit welchen Sie ein PIS im täglichen Arbeiten unterstützen kann.
Grundsätzlich gilt es bei der Evaluation folgende Punkte zu beachten, um Entäuschungen und Fehlentscheidungen vorzubeugen.
- Eine 100% Zufriedenheit werden sie mit einem System nicht erreichen. Auch beim optimalen PIS wird es Punkte geben, welche nicht ideal für Sie zugeschnitten sind. Probieren Sie darum, von den existierenden Systemen dieses auszuwählen, welches Ihrer Art zu arbeiten am ehesten entspricht.
- Gewissheit, wie sich die Lösung in der täglichen Verwendung tatsächlich bewährt, haben Sie erst nach der Entscheidung. Gerade deswegen ist es wichtig, dass Sie sich in der Evaluation so gut wie möglich in die echte Anwendung versetzen können; optimalerweise können Sie die Applikation einige Stunden oder sogar Tage als Demoversion testen.
- Falls Sie Ihr bestehendes System reevaluieren lohnt sich eine Umstellung aufgrund kleiner Optimierungen meist nicht. Die Lösung muss einen grösseren Mehrwert aufweisen, damit dieser auch tatsächlich im Alltag überwiegt.
- Sofern mit einem System effektiv Effizienzgewinne entstehen, sind leichte Kostenunterschiede vernachlässigbar.
Von der Evaluation bis zur Einführung eines Praxisinformationssystems anhand des 5 Schritte Modells
1. Zielsetzung definierenWieso wollen Sie ein neues System beschaffen? Diese Grundsatzfrage sollten Sie vor der Evaluation geklärt haben. Was möchten Sie auf strategischer Ebene mit der Veränderung erreichen? Was erhoffen Sie sich davon? Was sind Ihre Erwartungen? Falls Sie reevaluieren: Wieso wollen Sie wechseln? Was soll beim neuen System besser/anders sein? Halten Sie sich diese Vision beim weiteren Verlauf stets vor Augen.
2. Auswahl und Gewichtung der EntscheidungskriterienFormulieren Sie die Entscheidungskriterien, mit denen Sie die einzelnen Systeme vergleichen möchten. Involvieren Sie dabei immer Ihr Praxisteam Dabei sind unserer Erfahrung nach vor allem folgende Dimensionen zu beachten:
- Medizinisch, ärztliche Nutzung
- Praxisprozesse
- Interoperabilität (Schnittstellen zu Geräten oder anderer Software)
- Zukunftsfähigkeit
- Abrechnung
Achten Sie beim Erfassen der Kriterien darauf, dass Sie später die jeweilige Qualität eines Kriteriums bewerten können, um infrage kommende Systeme zu vergleichen. Wo es möglich ist, sollten Sie Prozesskriterien anstelle von Funktionen benennen. So sollte ein Kriterium also nicht einfach «Labor» oder «Agenda» heissen, sondern eher «Übersichtlichkeit Laborwerte» respektive «Workflow-Unterstützung Termineintragung». Die Erfassung dieser Kriterien ist ein wichtiger Schritt und kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Lassen Sie sich für den Inhalt von der Checkliste im Softwarekatalog inspirieren. Falls Sie auf eine bestehende, ausführliche Liste solcher Kriterien zurückgreifen und dabei nur noch die für Sie relevanten übernehmen möchten, empfehlen wir Ihnen unsere 5-Schritte-PIS-Evaluation. In dieser stellen wir Ihnen unter anderem eine bestehende Qualitätskriterienliste mit über hundert bewährten Kriterien zur Verfügung.
Da die Zeit in den Präsentationen oft nicht ausreicht, um sich alle Funktionen und Kriterien zeigen lassen zu können, sollten Sie die einzelnen Kriterien vorab priorisieren. Das ermöglicht Ihnen, mit den jeweiligen Herstellern Ihre Anforderungen beim wichtigsten Kriterium beginnend durchzugehen.
3. Hersteller auswählen und einladen
Für eine detaillierte Präsentation können Sie nicht alle Hersteller einladen. Anhand den von Ihnen definierten Killerkriterien können Sie nun 2-4 Hersteller auswählen und für eine Produktpräsentation einladen. Rechnen Sie pro Präsentation mit ca. 1.5-2 Stunden. Ihr Praxisteam sollte bei der Präsentation ebenfalls dabei sein.
Präsentationen der Systemhersteller
Anhand Ihrer Kriterien-Liste können Sie nun die Herstellerpräsentation beurteilen. Lenken Sie den Fokus der Präsentation auf Ihre Bedürfnisse und lassen Sie sich die einzelnen Prozessschritte zeigen. Stellen Sie sich dabei so gut wie möglich die tägliche Arbeit mit der Anwendung vor. Bewerten Sie die vorerfassten Kriterien jeweils einzeln, z.B. mit einer Skala von 0-10, was Ihnen erlaubt, die einzelnen Anbieter nach den Vorführungen besser vergleichen zu können. Fordern Sie auch Ihre Mitarbeiter dazu auf, Fragen zu stellen und die für Sie relevanten Kriterien zu bewerten.
Vergessen Sie nicht, am Schluss der Präsentation genügend Zeit für die Besprechung der Preise einzuplanen. Zusätzlich zur Offerte, welche Sie erhalten, ist es unter Umständen wichtig zu verstehen, welche Folgen eine Vergrösserung Ihrer Praxis (Workstations und/oder Personal) auf den Preis des jeweiligen Anbieters hätte.
4. Vergleichen und Entscheiden
Auf Basis der erarbeiteten Informationen treffen Sie nun Ihre Entscheidung. Für diese sind, wie bereits oben erwähnt, die Kosten zwar ein wichtiger Faktor, oft ist jedoch ausschlaggebender, wie effizient Ihre hoch priorisierten Prozessschritte mit dem System bearbeitet werden können. Wenn Sie sich mit einem System jeden Tag einige Minuten sparen, kann das oft auch grössere Kostenunterschiede wettmachen. Nach der Entscheidung können Sie sich durch den Anbieter bei der konkreten Planung und Einführung unterstützen lassen. Wichtig sind klar definierte Meilensteine, welche am besten auch vertraglich festgehalten werden.
5. Einführung / Migration
Denken Sie für die Einführung daran, dass Sie genügend Zeit für die Planung einrechnen, genug Schulung und Unterstützung in Anspruch nehmen und planen Sie «Puff erzeiten» ein, in welchen Sie die Herausforderungen und Schwierigkeiten zu Beginn abfedern können. Integrieren Sie Ihr Team in den Prozess, nehmen Sie Bedenken ernst und sorgen Sie für notwendige Unterstützung.
Wurde das Projekt mit Meilensteinen defi niert, können Sie diese schrittweise abnehmen und das Projekt nach erfolgreicher Installation und Schulung abschliessen.
Unterstützung durch healthinal
Falls Sie sich im Vorgehen für die Evaluation unterstützen lassen wollen, stehen wir Ihnen gerne mit unserer bewährten 5-Schritte-PIS-Evaluationsporzess zur Verfügung. Diese bildet den oben beschriebenen Prozess mit verschiedenen Vorlagen strukturiert ab und ermöglicht so einen objektiven Entscheid bei minimalem Aufwand Ihrerseits. Kontaktieren Sie uns dazu ungeniert telefonisch oder per E-Mail.
Zur Person
Tim Dorner, Project Manager
Healthinal GmbH
Herrenberg 35
8640 Rapperswil
Telefon 055 534 68 11
tim.dorner@healthinal.com
www.healthinal.com
Das elektronische Patientendossier (EPD) wird nach 15 Jahren Realität
Was macht die Schweiz anders oder gar besser? Wie kann das EPD (elektronisches Patientendossier) in einer Arztpraxis eingesetzt werden?
Seit 2022 können Patientinnen und Patienten ein EPD eröffnen. Die Einführung des EPD in der Schweiz war von einem langjährigen Strategie- und Umsetzungsprozess geprägt. Bereits im Jahr 2018 hat die Bertelsmann-Stiftung eine Studie zu Digitalisierungsstrategien, wozu das EPD gehört, im internationalen Vergleich publiziert.
Das elektronische Patientendossier (EPD), ist das Ergebnis eines rund fünfzehn Jahre dauernden Strategie und Umsetzungsprozesses. Knapp zwei Jahre nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das elektronische Patientendossier (EPDG) bleibt das Ziel des Bundes, ein schweizweites EPD einzuführen, unter seinen Erwartungen. Früh hat sich gezeigt, dass der Gesetzgebungsprozess den sich stetig verändernden technischen Entwicklungen sowie den organisatorisch-strukturellen Veränderungen, denen das Gesundheitswesen unterworfen sind, nur ungenügend Rechnung trägt. Da der digitale Austausch kein Selbstzweck ist, ist es unabdingbar auf die Bedürfnisse derjenigen einzugehen, die das EPD in ihrer täglichen Arbeit einsetzen möchten oder gar müssen.
Digitale Kompetenz als Erfolgsfaktoren
Digitalisierung heisst Wandel – und damit dieser gelingt, müssen alle beteiligten Akteure dafür bereit sein. Die Studie Bertelsmann-Stiftung über die Digitalisierungsstrategien im internationalen Vergleich[1] zeigt, dass ein Changemanagement einschliesslich der Förderung von digitalen Kompetenzen der Gesundheitsfachpersonen sowie der Bevölkerung ein entscheidender und vielfach vernachlässigter Erfolgsfaktor bei der Umsetzung einer nationalen eHealth-Strategie ist. Immerhin dokumentieren gemäss der aktuellen Umfrage der FMH «Digital Trends Survey 2021» mehr als 70% der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte elektronisch. Die Vorteile der elektronischen Krankengeschichte werden auch von 78% der Bevölkerung geschätzt[2]. Die Offenheit der Bevölkerung gegenüber der Digitalisierung im Bereich der Dokumentation und des Datenaustauschs zeigt sich auch in der Bereitschaft, ein EPD zu eröffnen. Für die Ärzteschaft ergeben sich hiermit gute Gründe, sich mit dem EPD auseinanderzusetzen und eine aktivere Rolle einzunehmen, um dadurch ihre Forderungen für ein nutzbringendes EPD besser einzubringen können.
Für die Bewältigung dieser Aufgabe bleibt für die ambulant tätige Ärzteschaft nicht mehr viel Zeit. Denn mit der KVG-Revision zur Zulassungssteuerung, die am 19. Juni 2020 verabschiedet wurde, müssen Ärztinnen und
Ärzte, die ab 1. Januar 2022 neu zur Abrechnung ihrer Tätigkeiten zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) zugelassen werden möchten, am EPD teilnehmen. Mit Annahme der Motion 19.3955 «Ein elektronisches Patientendossier für alle am Behandlungsprozess beteiligten Gesundheitsfachpersonen» der SGK-N am 8. März 2021 wird die Freiwilligkeit der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte gänzlich aufgehoben. Damit wächst der Druck auf die Ärzteschaft, die technischen und vor allem organisatorischen Veränderungen für die Anbindung einer Arztpraxis an das EPD zu planen.
Das EPD in der Arztpraxis einsetzen
Durch die Verpflichtung der Ärzteschaft zum EPD muss der Bund auch dafür sorgen, dass das EPD wirtschaftlich und zweckmässig eingesetzt werden kann. Ein optimaler Einsatz des EPD im Praxisalltag bedingt, dass die Anbieter/innen von Praxissoftwaresystemen die mit dem EPD verbundenen Arbeitsschritte ebenso optimal in deren Abläufe integrieren. Zwar geniesst die Förderung der Anbindung des EPD in die Praxissoftwaresysteme höchste Priorität in der eHealth-Strategie von Bund und Kantonen, jedoch zeigt die Umsetzung des EPD in den zertifizierten Stammgemeinschaften leider ein noch anderes Bild. Gemäss den Berichten zur formativen Evaluation des EPDG verfügen – wenn überhaupt – nur die wenigsten der untersuchten somatischen Spitäler, Rehakliniken oder psychiatrischen Institutionen über eine volle Integration des EPD in deren Primärsysteme[3]. Diese Entwicklung könnte nun zur Stolperfalle und sogar den eigentlichen Nutzen des EPD in Frage stellen, da vielerorts die Daten im EPD aufwändig erfasst werden müssen. In dieser Stolperfalle befinden sich auch Vorzeigeländer wie Israel. Gemäss der Bertelsmann-Studie ist der interoperable Datenaustausch in Israel zwischen privaten und staatlichen Gesundheitseinrichtungen aufgrund des mangelnden Willens nur zu einem Teil möglich. Was ist also zu tun?
Für eine digitale Zukunft der Gemeinschaft der Ärztinnen und Ärzte
Die FMH hat bereits 2014 darauf hingewiesen, dass freischaffende Ärztinnen und Ärzte selbst handeln müssen. Es gilt, eine eigene Infrastruktur aufzubauen, welche die Kosten für den einzelnen minimiert, ihm den Anschluss an bestehende und kommende eHealth-Lösungen ermöglicht und dennoch den Schutz aller Patientendaten garantiert[4]. Im Hinblick auf diese Vision gründeten die FMH, die Ärztekasse und HIN gemeinsam die AD Swiss, welche sich unter anderem für den Aufbau einer EPD Gemeinschaft einsetzt. Die daraus hervorgegangene AD Swiss EPD Gemeinschaft ist eine im EPDG definierte organisatorische Einheit von Gesundheitsfachpersonen und die einzige EPD-Gemeinschaft in der Schweiz.
Die AD Swiss stellt den Mitgliedern der AD Swiss EPD Gemeinschaft einen gesetzeskonformen Zugang zum EPD zur Verfügung[5]. Das Gesetz, die Technik bzw. die zugrundeliegenden Standards und alle (Stamm-)Gemeinschaften garantieren die Kompatibilität untereinander. Damit haben Mitglieder der AD Swiss EPD Gemeinschaft in allen Kantonen der Schweiz Zugang zu den Dossiers ihrer Patientinnen und Patienten – unabhängig davon, welcher Stammgemeinschaft beispielsweise die Spitäler und andere Leistungserbringer in der Region angehören.
Dieser Service richtet sich ausschliesslich an Gesundheitsfachpersonen und deren Organisationen. Neben einem Portalzugang wird der EPD-Service künftig auch via angeschlossene Primärsysteme genutzt werden können. Somit steht einer Integration des EPD in die Arztpraxis nichts mehr im Weg. Der Zentralvorstand der FMH empfiehlt den Mitgliedern der FMH den Anschluss an die ärzteeigene AD Swiss EPD Gemeinschaft[6].
Quellenverzeichnis
[1] https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/smarthealthsystems
[2] https://www.fmh.ch/themen/ehealth/trends-neue-technologien.cfm#i151557
[3] https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/evaluationsberichte/evalber-gesundheitsversorgung.html#accordion1635155595647
[4] https://saez.ch/journal le/view/article/ezm_saez/de/saez.2014.02896/1bfee632be4a24db05aece70903d313234979c75/saez_2014_02896.pdf/rsrc/jf
[5] https://www.ad-swiss.ch/ad-swiss-epd-gemeinschaft/mitgliedwerden/
[6] https://www.fmh.ch/ les/pdf25/position-der-fmh-zum-epd.pdf
Zur Person
Reinhold Sojer, Leiter Abteilung Digitalisierung/eHealth der FMH
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH
Elfenstrasse 18
3006 Bern
Telefon 031 359 11 11
info@fmh.ch
www.fmh.ch